Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Nachwort und Ausblick
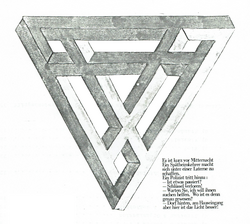
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Nachwort und Ausblick
Im Vorwort zu dieser Arbeit habe ich meine Vorgehensweise als 'wissenschaftstheoretische Feldstudie' etikettiert. Die vier Kapitel stellen aus dieser Perspektive die theoretischen Vorarbeiten (I & II) und die Datenerhebung (III & IV) dar. Die Integration der Daten erfolgte jeweils am Ende der einzelnen Erhebungen unter dem Etikett 'Modellevaluation'.
Ich will jetzt versuchen, ein Gesamtbild zu erstellen und die dabei auftauchenden Fragen und Probleme zusammenzufassen. Besondere Beachtung gilt dabei den Gemeinsamkeiten von Modellen innerhalb einer Disziplin. Die Reihenfolge der Disziplinen vertausche ich hier um wieder von außen nach innen vorstoßen zu können.
Ganz allgemein lassen sich die Quellen der in dieser Arbeit behandelten Ansätze in zwei Gruppen teilen:
- natürliche Quellen - Das sind Quellen, die unabhängig von menschlichem Tun, d.h. von Technologie und Kultur, existent sind. Das Immunsystem ist ein Repräsentant dieser Gruppe.
- nicht natürliche Quellen - Entsprechend sind diese Quellen nicht unabhängig von menschlicher Technologie und Kultur. Beispiele sind der Digitalrechner und das Telefonsystem.
Bedeutsam ist diese Unterscheidung unter folgender Prämisse: Aus evolutionstheoretischer Perspektive müssen Lebewesen, und insbesondere Menschen, als Produkte des sie umgebenden Mediums begriffen werden.
Auf diese Weise ergibt sich eine Hierarchie von Produzenten in der Reihenfolge Natur -> Mensch -> Technologie. Eine Gruppe der Quellen entstammt so der Menge der Produzenten, die andere dagegen der Menge der Produkte menschlicher Existenz.
Betrachtet man die Quellen aus der Cognitive Science, offenbart sich ein starkes Übergewicht von nicht natürlichen Modellen. Innerhalb dieser Gruppe wiederum gelten der Digital-Technologie die meisten Sympathien.
natürliche Quellen[1]:
9) Immunologie 10) visuelles System
nicht natürliche Quellen:
1) Digital-Technik (Schieberegister) 2) Digital-Technik (CPU) 3) CPU mit Eingabe-, Ausgabe- und Speicherdevices & Arbeitspuffer 4) mathematische Graphentheorie 5) Gesetz der Ekphorie von R. SEMON 6) Ähnlichkeitsmaße 7) Levels of Processing 8) SAM 11) Graphentheorie 12) Radioröhre
Das ist weiter nicht verwunderlich, wenn man berücksichtigt, daß im Forschungsbereich des 'information-processing-Ansatzes' das menschliche Gehirn als eine besondere Art von Computer betrachtet wird.
Wie ich bereits mehrfach betont habe, sind existentielle Hypothesen mit dieser Quelle nicht zu leisten. Die Digital-Technologie bildet bislang nur einen kleinen Ausschnitt menschlicher Fähigkeiten ab.
Auch die momentan voller Euphorie dokumentierte Entwicklung sogenannter 'Vektorrechner' ist nicht gerade revolutionär: Gemessen an Prozessen menschlicher Informationsverarbeitung ist auch diese hochkomplexe Technologie nur eine vereinfachte Kopie.
Berücksichtigt man überdies neuere Ansätze aus der Cognitive Science, dann ist ein vorherrschendes Interesse erkennbar, menschliche Fähigkeiten als Software zu kopieren. Das mag einerseits den Wunsch nach einer Validierung der theoretischen Ansätze ausdrücken. Auf der anderen Seite bleibt die Frage bestehen, ob eine funktionierende Software Rückschlüsse auf menschliche Phänomene ermöglicht und ob so ein relevanter Informationszuwachs erreicht werden kann.
Meiner Untersuchung zufolge kann sich kein Ansatz aus der Cognitive Science dem ROSEschen Argument entziehen: "Allein das Funktionieren einer Software ist noch kein hinreichendes Indiz für die Behauptung, daß ein ZNS in gleicher Weise operiert. Prinzipiell sind unendlich viele Software-Kopien desselben Phänomens denkbar."
Für die Cognitive Science läßt sich also festhalten, daß verschiedene Phänomene mit Software modelliert werden können, eine Validierung der Modelle bezüglich der internen Organisation der Vorgänge aber noch aussteht.
Nicht angesprochen ist dabei das Problem einer steuernden Instanz. Im Fall der Software ist klar, wer die Organisation der Prozesse definiert. Bei der Anwendung auf menschliche Abläufe schafft diese Idee - für einen Monisten sowieso - ernsthafte Probleme.
Die Modelle der Neuroscience besitzen demgegenüber einen wichtigen Vorteil:
Ihre Mechanismen sind wesentlich einfacher zu validieren.
Ein Grund dafür ist die weitgehende Beschränkung auf die Untersuchung von Produkten, die einer Beobachtung vergleichsweise leicht zugänglich sind. Ein weiterer Grund liegt im Analyseniveau: Die Neuroscience forscht direkt am Substrat, das als Träger der jeweiligen Phänomene in Frage kommt. Als Entsprechung ist ein höherer Anteil an natürlichen Quellen zu verzeichnen:
natürliche Quellen:
2) DNS = Erbsubstanz 3) 'labeling' (Immunologie) 5) konditionierter Reflex 6) Ökologie: 'Sukzession' & 'Klimax'
nicht natürliche Quellen:
1) öffentl. Pressewesen 4) Vermittlungssystem im öffentlichen Fermeldewesen 7) Digital-Technologie
Obwohl die Neuroscience mit der Validierung ihrer Speichermodi weniger Probleme hat als die Cognitive Science, gibt es auch hier Bereiche, die der Beobachtung nicht direkt zugänglich sind. So ist noch kaum geklärt, wie gespeicherte Information wieder nach außen gelangt: Das Ablesen hinterläßt anscheinend keine Spuren!
Gleiches gilt für intern ablaufende Verarbeitungsprozesse: Hier ist mit direkter Beobachtung kein Vorteil mehr zu erzielen. Es ist derzeit noch unmöglich, die Aktivität von Millionen von Nervenzellen mithilfe irgendeines Formalismus zu beschreiben.
Für einen Monisten haben die Vertreter der Neuroscience immerhin die Erkenntnis zur Hand, daß da nirgendwo im ZNS ein steuernder Homunculus sitzt.
Wie die Steuerung allerdings dann funktioniert, ist ihnen auch noch ein großes Rätsel. Auch in der Neuroscience wird dieser Bereich mangels geeigneter Ideen bisher kaum thematisiert.
Faßt man das bisher Gesagte zusammen, dann ergibt sich folgendes Bild:
Je näher am Träger der Phänomene geforscht wird, umso leichter lassen sich Paramorphismen auf der Grundlage anderer Prinzipien aus der Natur konstruieren. Dies bezieht sich lediglich auf die relativ statischen Aspekte von Gedächtnis. Vorgänge des Ablesens oder des internen Informationsflusses sind auf diese Weise nicht mehr faßbar.
Wechselt man von der Substrat-Ebene auf die Phänomen-Ebene aus, besteht die Möglickeit, Prozesse zu modellieren. Die Repräsentation von Information muß in diesem Fall den Forderungen der Software genügen. Eine Validierungsmöglichkeit für die so postulierte Organisation der Informationsrepräsentation existiert nicht.
Dieses Resume mag angesichts des gewaltigen Aufwands an Forschungsaktivitäten innerhalb der Gedächtnisforschung beider Disziplinen als sehr enttäuschend empfunden werden. Es scheint trotz aller Erkenntnisse der Neuroscience bezüglich Modalität und Lokalität der Speicherung kein wirklicher Fortschritt stattzufinden.
Nach meiner Überzeugung liegt ein Grund für diese Situation in einer fehlenden Vorstellung von den Besonderheiten lebender Systeme. Neuroscience wie Cognitive Science versuchen noch immer, lebende Organismen als Maschinen zu verstehen, denen irgendwer einmal den Odem verabreicht hat.
Auf diesem Weg gelangt man dann ständig zu der Frage, "Wer war das?" oder "Wie hat er das gemacht?".
Humberto H. MATURANA, ein Neurobiologe, bemüht sich seit dem Anfang der sechziger Jahre um die Formulierung einer biologischen Theorie lebender Systeme[2]. Diese Theorie hat mittlerweile eine solche Komplexität erlangt, daß ihre bloße Zusammenfassung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Zum Ausblick möchte ich wenigstens die Leitideen MATURANAs kurz streifen.
Die Identität eines Organismus definiert sich nach MATURANA durch seine Organisation. Sämtliche Aktivitäten, die im Organismus ablaufen, müssen so beschaffen sein, daß durch sie die Organisation nicht varändert wird. Ein lebender Organismus ist in dieser Perspektive ein Homöostat, dessen Stellgröße seine Organisation ist.
Das Nervensystem, mithilfe dessen ein Organismus integriert wird, operiert wie ein geschlossenes System! Dieser Satz ist ein tragendes Element in MATURANAs Theorie, aus dem sich eine Reihe von Folgerungen ergeben:
- Es gibt für den Organismus kein Innen und Außen. Die Umwelt ist dabei ein Bindeglied zwischen den effektorischen und sensorischen Systemen eines Organismus. Es ist dann unnötig, von Repräsentationen zu sprechen.
- Wenn keine Repräsentationen angenommen werden müssen, dann braucht auch keine Informationsaufnahme postuliert zu werden.
- Wenn keine Information aufgenommen wird, dann kann auch kein (adäquates) Verhalten errechnet werden. Der Organismus lebt somit nur in der Gegenwart; die internen Vorgänge sind in jedem Moment nur durch die Struktur des Organismus bestimmt.
- Wenn die Vorgänge im Nervensystem strukturdeterminiert sind, dann kann bedeutungsvolles Verhalten nicht aus den internen Prozessen heraus, sondern nur im Kontext einer konkreten Situation erklärt werden.
Dieses besondere Verhältnis von Organismus und Umgebung wird mit zwei weiteren Grundlagen etwas klarer. Zunächst bestimmt MATURANA zwei einander nicht überschneidende Phänomenbereiche:
- struktureller Bereich: Dieser Phänomenbereich umfaßt alles, was innerhalb des Organismus geschieht. Das Etikett betont besonders die strukturelle Eigendynamik (s.o.) des Organismus.
- Interaktionsbereich: Dies ist der Phänomenbereich, in dem die Strukturänderungen des Organismus sich auf die Struktur der Umgebung auswirken. Ein Beobachter in dieser Umgebung würde seine Beobachtung als Verhalten oder Interaktion beschreiben.
Da der Organismus als geschlossenes System arbeitet, für das der Unterschied zwischen Innen und Außen völlig unerheblich ist, führt MATURANA den Begriff der 'strukturellen Koppelung' ein. Damit werden im Prinzip die Phänomene im Interaktionsbereich bezeichnet: Jede Veränderung in der Struktur des Organismus führt zu Änderungen in der Struktur der Umgebung und vice versa.
Mit dieser Prämisse gelangt MATURANA zu einem materialistischen Verständnis des Leib-Seele-Problems. Die aktuelle Struktur des Organismus ist danach das Ergebnis der Geschichte seiner strukturellen Kopplung an seine Umgebung, sowie der Dynamik seiner internen Zustandsänderungen.
Mit diesen wenigen Leitideen MATURANAs wandelt sich die theoretische Situation, in der die Probleme des Gedächtnisses angegangen werden.
Das Problem der Repräsentationen ist nicht mehr existent. Nach Ansicht MATURANAs besteht die ganze Information, die ein Organismus braucht, in seiner augenblicklichen Struktur.
Das Problem der Steuerung hat sich fast ebenso leicht gelöst. Einerseits gibt es keine steuernde Instanz im ZNS außer seiner Struktur, die aber Produkt seiner Geschichte ist. Andererseits ist die einzige Konstante im Organismus dessen Organisation. Letztere sowie der Bereich struktureller Wandlungen sind phylogenetisch so bestimmt, daß eine Erhaltung der Organisation möglich wird, d.h. der Organismus kann überleben.
Dieser Ausschnitt aus MATURANAs Theorie der Organisation des Lebendigen soll als Ausblick genügen. Trotz z.T. äußerst grotesk anmutender Vorstellungen könnte sie, gerade aufgrund dieser unkonventionellen Perspektive, einige Antworten zu den Problemen der von mir untersuchten Ansätze der Gedächtnisforschung vorzeichnen. MATURANAs Vorstellung eines Paradigmas zur Erforschung lebender Systeme verwirft die Methode des Kopierens einzelner vom Kontext des Organismus getrennter Phänomene:
"Viele Wissenschaftler, die sich mit Automatentheorie befassen, suchen die außergewöhnlichsten der von lebenden Systemen erzeugten Phänomene zu modellieren, z.B. Autonomie, Sprache, Bewußtsein. Diese Ziele können jedoch nicht erreicht werden, solange es keine Theorie gibt, die zeigt, worin die Einzigartigkeit dieser Phänomene besteht und wie diese in biologischen Systemen entstehen."[3]
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann