Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Plastizität
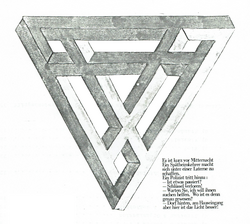
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Plastizität
Ein Ansatz, der eine Speicherung von Information in der Struktur des ZNS zugrundelegt, sich also vom zuvor dargestellten in der 1962 von FOERSTER geforderten Weise[1] unterscheidet, stammt aus der Forschungsbereich der synaptischen bzw. neuronalen Plastizität.
Der Terminus Plastizität ist auf allen relevanten Analyseniveaus definiert:
- Auf dem zellulären Niveau steht er für die strukturelle Variabilität eines Neurons, d.h. Anzahl und Position von Synapsen bzw. Kollateralen;
- auf dem organischen Niveau lassen sich die aus (i) resultierende veränderte Organisation (i.e. neuronale Verschaltung) verschiedener ZNS-Regionen damit bezeichnen;
- auf dem Niveau des Organismus schließlich, wird die Variabilität des Verhaltens, zunächst unabhängig von (i) und (ii), als 'behaviorale' Plastizität etikettiert.
Vollzieht man den Schritt vom 'behavioral-neuronalen' Parallelismus oder Interaktionismus zu einem Monismus desselben Typs, dann ist der Weg frei für eine Gedächtnistheorie, die behaviorale und neuronale Plastizität als Pendants auf verschiedenen Ebenen verwendet.[2]
Generell lassen sich zwei Arten von neuronaler Plastizität beobachten:
- Modifikation der Struktur des ZNS. Dieser Prozess wurde ursprünglich mit der vollständigen Ausbildung des Nervensystems als abgeschlossen betrachtet. Mittlerweile besteht Anlass, diese Annahme in Zweifel zu ziehen. COTMAN & NIETO-SAMPEDRO gehen davon aus, daß im ZNS wie auch im PNS ständig neue Synapsen sich bilden und andere degenerieren.[3] Sie verwenden dafür den Term 'synaptic turnover', den ich im Folgenden beibehalten werde.
- Ersetzen von Synapsen bzw. Kollateralen nach Verletzungen.[4] Da Neurone sich nicht wie andere Zellen eines Organismus ständig vermehren, kann sich 'Ersetzen' nur auf das Nachwachsen von Kollateralen und Synapsen beziehen; durch Verletzung verlorene Neurone können nicht ersetzt werden.
Da Gedächtnisprozesse, die auf der Basis einer permanent sich ändernden Organisation gewisser Bereiche des ZNS zu suchen wären, praktisch nicht beobachtbar sind, muß dieser Ansatz (mit den gegenwärtig vorhandenen Methoden) immer zugrundelegen, daß:
"reactive synaptic growth and synapse renewal are just an extension of the normal operation and maintenance of brain circuits. [...] that synapse turnover is an ongoing process which can be readily elicited by certain stimuli to produce morphological and physiological plasticity. [...] Such responses can be considered as a basic property of ensembles of nerve connections, [...]."[5]
Folgerungen ähnlichen Wortlauts haben bereits ROSE, MALIS & BAKER aus ihren Experimenten mit Deuteron-Strahlen-Läsionen im Jahre 1960 gezogen.[6] Die oben getroffene Unterscheidung von reaktiver Synaptogenese und spontanem Turnover ist demnach nur empirisch sinnvoll; theoretisch sind die zugrundeliegenden Prozesse nicht verschieden. Die Erforschung synaptischer Plastizität kann sich also auf die reaktive Synaptogenese beschränken. Drei Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Forschungsgebiets:
- Welche Regionen weisen synaptische Plastizität auf?
- Wodurch wird die Bildung neuer Synapsen stimuliert?
- Wie sieht der Mechanismus dieser Erneuerung aus?
Im Hinblick auf eine Gedächtnismodell ist die erste Frage nur von sekundärem Interesse. Frage (ii) wird durch die Bezugnahme auf Gedächtnis beantwortet:
"Die Bildung neuer Synapsen wird (auch) durch Erfahrung verursacht."
Frage (iii) schließlich führt über die Annahme hypothetischer Mechanismen im Rahmen eines Modells zur Formulierung existentieller Hypothesen:
exH1: Da Verhaltensänderungen immer stattfinden (müssen), muß auch die neuronale Struktur ständiger Veränderung unterworfen sein.
exH2:%Wenn Verhaltens-Plastizität ihre Entsprechungen in neuronaler Plastizität hat, dann muß für Verhaltensänderungen auch eine Änderung der neuronalen Struktur beobachtbar sein.
Die erste Hypothese kann in dieser Form bereits als bestätigt angesehen werden, wenn sich zeigen läßt, daß auch im entwickelten Organismus ein synaptischer Turnover stattfindet. Dies gilt unabhängig davon, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen Erfahrung und Turnover angenommen werden darf.
Hypothese exH2 ist eine Spezifizierung von exH1 derart, daß die Annahme einer Kausalbeziehung direkt testbar wird.
Daß die synaptische Verschaltung im ZNS variiert ist eine altbekannte Tatsache, wenn man Nervensysteme in der Entwicklungsphase untersucht. Mit dem Ende dieser Periode wurden solche Prozesse als abgeschlossen betrachtet. Verschiedene Untersuchungen lassen allerdings den Schluß zu, daß in manchen Regionen des ZNS auch danach ein ständiger Turnover stattfindet. Da es mit keiner Methode bislang gelungen ist, neue Synapsen von zuvor bereits vorhandenen zu unterscheiden, müssen andere kritische Indikatoren zur Feststellung von Turnover herangezogen werden.
Eine verbreitet angewandte Methode basiert auf der Annahme, daß sogenannte postsynaptische Verdichtungen, welche nicht von einem präsynaptischen Terminal belegt sind (vacant postsynaptic densities), eine Rolle bei der Bildung neuer Synapsen spielen, und damit als Index für die Erneuerung von Synapsen in Frage kommen.
Eine weitere Methode stützt sich auf Phänomene, die sich bei degenerierenden Axonen beobachten lassen: 'Herring bodies' genannte Verdickungen eines Axons stellen eine Vorstufe der Degeneration dar.
Aufgrund der beschriebenen Indikatoren kann z.B. angenommen werden, daß: - die bipolaren sensorischen Neuronen im olfaktorischen System, bzw. deren Synapsen im bulbus olfactorius, einem Turnover-Zyklus von 10-20 Tagen unterliegen;
- im Vestibularsystem, besonders im nucleus vestibularis lateralis, möglicherweise als Reaktion auf sich ändernde Gleichgewichtsverhältnisse, ein ständiger Turnover stattfindet;
- die Axone im Hypothalamus ebenfalls permanent durch neue ersetzt werden;
- Turnover auch im Cerebellum, im nucleus interpositus sowie in den nuclei cuneati auftritt.
Die Frage nach der Existenz (exH1) von permanentem Turnover im erwachsenen Organismus kann bereits auf dieser Datengrundlage positiv beantwortet werden. Zu zeigen bleibt noch, ob diese Plastizität etwas mit den Erfahrungen des jeweiligen Wesens zu tun hat (exH2).
Das Paradigma, mit dem der Effekt von Erfahrung auf die neuronale Struktur untersucht wird, besteht allgemein in einfachen experimentellen Designs:
Eine Gruppe erwachsener Tiere wird in Experimental- und Kontrollgruppe aufgeteilt. Die Experimentalgruppe wird dann für eine Periode von durchschnittlich etwa 50 Tagen in einer Umgebung gehalten, die sich durch eine besonders abwechslungsreiche Gestaltung auszeichnet (enriched environment).
Vergleicht man die beiden Gruppen nach dieser Periode miteinander, dann läßt sich bereits nach 30 Tagen eine Zunahme synaptischer Endigungen in den Cortexschichten II und III, sowie ein Wachstum der Verzweigungen bei basalen Dendriten feststellen.[7]
Unmittelbar als Konsequenzen von Lernprozessen lassen sich die Ergebnisse von PYSH & WEISS interpretieren: Sie variierten nicht die visuellen Anreize in der Umgebung der Tiere, sondern deren Bewegungsfreiheit. Bereits nach 17 Tagen konnten sie bei der Experimentalgruppe 23 Prozent mehr Synapsen auf den Purkinje-Zellen im Cerebellum entdecken als bei ihrer Kontrollgruppe.[8]Die beiden skizzierten Ergebnisse lassen mit einiger Vorsicht noch den Schluß zu, daß Erfahrung einen Einfluß auf die Struktur des ZNS hat, was einer Bestätigung von exH2 aber nicht ganz gleichkommt, denn:
Die semantische Gleichbehandlung von Erfahrung und Gedächtnis birgt gewisse Probleme, die nicht unterschlagen werden dürfen. Während Erfahrung ohne Weiteres mit dem oben beschriebenen Paradigma des 'enriched environment' untersucht werden kann, erscheint mir die Relevanz dieser Ergebnisse für die Erforschung von Gedächtnis doch sehr zweifelhaft. So kann sich der Effekt einer vielfältigeren Umgebung statt in bloßer Informationsaufnahme (=>Gedächtnis) auch in komplexer werdenden Routinen der Informationsverarbeitung bemerkbar machen. Beides kann als Erfahrung bezeichnet werden, aber nur der erste Fall gilt als Gedächtnis.
Argumente für diesen Einwand finden sich auch in Untersuchungen zum Mechanismus des synaptischen Turnover. Zwei Gruppen von Experimenten lassen sich unterscheiden:
- Lähmung von Neuronenfortsätzen mittels geeigneter Substanzen. TTX (Tetrodotoxin) ist eine Substanz die jegliche Fortleitung von Impulsen über ein Axon unterbindet ohne das Neuron anderweitig zu schädigen. Wird ein Axon eines Motoneurons mittels TTX mehrere Tage gelähmt, dann ist ab dem dritten Tag ein Wachstum der Afferenzen des betroffenen Muskels zu beobachten. Dieselben Effekte lassen sich erzielen, wenn man die Freisetzung von ACh (Acetylcholin) mit dessen Antagonisten botulinum toxin verhindert. Verhindern lassen sich die Effekte beider Manipulationen, wenn man den Muskel mit entsprechenden elektrischen Spannungen stimuliert.
- elektrische Stimulation ist auch ein Mittel, die Bildung neuer Synapsen zu provozieren. Reizt man beispielsweise die Fasern des corpus callosum, so zeigt sich eine Veränderung der Dendriten in den Schichten II und III: Sie werden groeßer, komplexer und entwickeln mehr Synapsen als solche in Vergleichsobjekten.[9] Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß synaptische Plastizität eine wichtige Funktion innerhalb der Selbstoptimierung des ZNS innehat. Gleichzeitig wird die Hoffnung, Informationsspeicherung und synaptische Plastizitaet als Äquivalente betrachten zu können, um ein gutes Stück geringer.
Die bisherige Untersuchung dieses Ansatzes hat eine Reihe seiner modellspezifischen Charakteristika enthüllt, die ich jetzt wieder schematisch zusammenfassen will.
- Modellevaluation
*==============*===============*================*===============* | | | | | | Phänomen | Trans- | hypothetischer | Quellen | | | formationen | Mechanismus | | | | | | | +--------------+---------------+----------------+---------------+ | | | | | | permanentes | intern vorh. | Nervensystem | Vermittlungs- | | (Langzeit-) | Reizkonfigur. | optimiert | system im | | Gedächtnis | ====> | Informations- | öffentlichen | | >>Engramme<< | Struktur des | fluß durch Um- | Fermeldewesen | | | Nervensystems | strukturierung | | | | | | | *==============*===============*================*===============*
Die Annahme eines Telephonvermittlungssystems als Quelle kann innerhalb der Entwicklung dieses Ansatzes nicht aufrechterhalten werden. Der Beginn dieser Forschungstradition ist eher bei einer schlichten Parallelisierung von behavioraler und neuronaler Plastizität zu suchen. Ihrer Plausibilität tut dies allerdings keinen Abbruch. Auch in einen Vermittlungssystem werden nach Bedarf neue Leitungen geschaltet bzw. bestehende unterbrochen.
Die Formulierung eines hypothetischen Mechanismus auf dieser Grundlage ist bisher kaum zu verzeichnen. Zweifelhaft ist auch, ob ein Gedächtnismodell auf dieser Grundlage überhaupt zu erstellen ist. Der außerordentlich dynamische Prozess des synaptischen Turnover erscheint eher als Anpassung an die extern gegebene Reizsituation, denn als Äquivalent von Speicherprozessen.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ vgl. Foerster,H.von (1965): 'Memory Without Record'
- ↑ Ursprünglich stammt diese Idee von CAJAL, TELLO u.a.; neu daran ist ihre massive Unterstützung durch experimentelle Befunde.
- ↑ vgl. Cotman,C.W. & Nieto-Sampedro,M. (1982): Brain Function, Synapse Renewal, and Plasticity.
- ↑ vgl. 'Paradigmen' in Abschnitt a) dieses Kapitels
- ↑ vgl. Cotman & Nieto-Sampedro (1982) S.372
- ↑ vgl. Rose,J.E., Malis,L.I., and Baker,C.P.: 'Neural Growth in the Cerebral Cortex after Lesions Produced by Monoenergetic Deuterons.' in: Pribram,K.H. (1969): 'Brain and Behaviour 3'
- ↑ Uylings u.a. (1978) in Cotman & Nieto-Sampedro (1982) S.381
- ↑ Pysh & Weiss (1979) in Cotman & Nieto-Sampedro (1982) S.381f
- ↑ vgl. Cotman & Nieto-Sampedro (1982) S.384ff