Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Überblick 3: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 3}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 3}} | ||
;Überblick | |||
Für einen Neurowissenschaftler entstehen (auf der Basis eines materialistischen Monismus) zunächst eine Reihe von Fragen, die ich vorab in einen Komplex inhaltlicher und einen Komplex methodischer Fragen aufteilen will: | |||
Inhalt | |||
#Von welcher Art sind Veränderungen im Organismus, die sich als Gedächtnis bezeichnen lassen? | |||
#Und: Auf welchem Organisationsniveau ist es sinnvoll, sie zu untersuchen? | |||
#Überhaupt: Wie hat man sich das interne Vokabular, den Code des ZNS vorzustellen? | |||
#Weiterhin: Gibt es verschiedene Gedächtnisse, die den einzelnen Sinnesmodalitäten zugeordnet werden können? | |||
#Oder: Gibt es andere Kriterien, nach denen Arten von Gedächtnis unterschieden werden müssen? | |||
#Schließlich: Gibt es eine spezielle Gedächtnisregion und wo befindet sich dieser 'Seat of Memory'? | |||
Methoden | |||
#Wie lassen sich Phänomene die als mit Gedächtnis assoziiert gedacht werden können, entdecken und beobachten? | |||
#Gibt es eine notwendigen Unterschied zwischen Methoden zur Erfassung von Prozessen, und solchen zur Erfassung von Produkten? | |||
#Gibt es methodenspezifische Artefakte? | |||
Auf die methodischen Fragen will ich gleich hier eingehen, da sie zur Darstellung von Forschungsergebnissen logischerweise als Grundlage notwendig sind. Besondere Beachtung soll dabei den verschiedenen Paradigmen der Beobachtung (i) gelten. | |||
Paradigmen | |||
#Läsionen: Die Methode der Läsionen (= Verletzungen) läßt sich grob in zwei Teilbereiche untergliedern: | |||
Die sogenannten 'split-brain-Experimente' sind die populärsten Vertreter eines Paradigmas in dem die Interaktion verschiedener Gehirnregionen mittels einfachem Durchtrennen ihrer Verbindungen untersucht wird. In einem split-brain-Experiment wird beispielsweise der 'corpus callosum' (der 'Balken'), ein dickes Bündel von Axonen welches die beiden Gehirnhemisphären verbindet, durchtrennt. Dadurch werden eine Reihe von Konsequenzen auf der Verhaltensebene sichtbar die dann wiederum Rückschlüsse auf Vorgänge im zellulären Bereich ermöglichen. | |||
Analog dazu läßt sich die Bedeutung einzelner Regionen oder Strukturen untersuchen. Sie werden (meist) auf operativem Wege entfernt ('surgical removal') was auch wieder Folgen auf der Verhaltensebene zeigt etc...! | |||
#Pathologie: Der Bereich Pathologie ist eng mit dem der Läsionen verknüpft. Läsions-Experimente am Menschen sind ethisch durch nichts zu rechtfertigen, und so ist hier das Ergebnis von Unfällen, Krankheiten und dadurch notwendig gewordener Eingriffe Gegenstand der Untersuchungen. Sehr starken Auftrieb erfuhr dieses Vorgehen während des Ersten Weltkrieges, wo Tausende von Gehirnverletzungen studiert werden konnten. | |||
Als Zyniker würde man dieser Methode wohl den Leitsatz "Wat dem eenen sin Uhl ..." unterstellen, was aber bestimmt nur einen ganz kleinen Teil der Wahrheit wiedergibt! | |||
#alterungsbedingte Veränderungen: Wenn man annimmt, daß Lernvorgänge keine Einzelerscheinungen sind, sondern im Rahmen einer ständigen Veränderung des gesamten Organismus betrachtet werden müssen, dann liegt der Schluß nahe, alterungsbedingte Veränderungen im ZNS als Effekte von Lernprozessen anzusehen. Diese Methode ist im Unterschied zu den beiden vorigen eher geeignet, Vorgänge im molekularen Bereich zu untersuchen. | |||
#chemische Manipulationen: Dieses Paradigma zielt ebenfalls auf Vorgänge in molekularen Größenordnungen. Bei der Suche nach manifesten Veränderungen durch Lernvorgänge werden beispielsweise proteinsynthesehemmende Substanzen verabreicht, um festzustellen, ob der Metabolismus (spezieller) Proteine mit der Bildung permanenter Spuren zusammenhängt. | |||
Chemische Manipulationen können auch als (unblutige) Ergänzung zur Läsionsmethode (s.o.) gesehen werden: Mit speziellen Chemikalien ist es möglich, die Funktion ganzer Bereiche lahmzulegen ('spreading-depression-technique'). Dadurch lassen sich deren Ausfälle untersuchen, ohne sie operativ zu entfernen. Da dieses Vorgehen nicht zu irreversiblen Schädigungen führt, ermöglicht es darüberhinaus die Untersuchung von Ausfällen spezifischer Strukturen im menschlichen ZNS. | |||
#'single-unit-recording' & 'stimulation technique': Vorgänge auf zellulärem Niveau schließlich lassen sich untersuchen, indem man die elektrische Aktivität eng beieinander liegender oder sogar einzelner Zellen beobachtet. Dies kann auf zweierlei Arten erfolgen: | |||
Die Aktivität kann mittels direkt in die interessierende Region eingeführten 'Mikroelektroden' registriert und aufgezeichnet werden. Diese Methode wird als 'single-unit-recording' bezeichnet. Bei den zum Teil sehr weitreichenden und komplexen Verschaltungen ist es damit jedoch nur begrenzt möglich, etwas über die Funktion bestimmter Zellgruppen auszusagen. Der Anwendungsbereich dieser Methode liegt deshalb eher in der Untersuchung kleiner 'überschaubarer' Nervensysteme, wie etwa dem des Octopus, der Biene oder der Schnecke. | |||
Benutzt man die Umkehrung dieser Methode ('stimulation technique') als Ergänzung, kann man zu Aussagen kommen, deren Form derjenigen logischer Sätze von der Art 'genau dann wenn ...' entspricht: | |||
"Zeigt ein Organismus%X das Verhalten%Y, dann sind Neuronen der Region%Z in charakteristischer Weise aktiv. Werden die Neuronen der Region%Z durch externe elektrische Impulse stimuliert, dann zeigt der Organismus%X das Verhalten%Y«."# | |||
.in0<ref>Y%und%Y« repräsentieren hier intraindividuell äquivalente Verhaltensweisen oder Zustände.</ref>Unabhängig von dieser nach verschiedenen Zugangsweisen gefundenen Anordnung existieren weitere Kriterien die eine Charakterisierung der Methode ermöglichen. Eines, das in diesem Kontext noch von Interesse sein wird, ist die Unterscheidung von Experimenten 'in vitro' vs. 'in vivo'. In vivo drückt aus, daß Vorgänge im lebenden Organismus studiert werden. Entsprechend weist 'in vitro' auf die Untersuchung isolierter Gewebeteile hin, die sich gewöhnlich in einem Millieu befinden, in dem sie für einige Zeit noch als lebend bezeichnet werden können. | |||
Die Frage nach Unterscheidung von Methoden zur Untersuchung von Prozessen und solchen für Produkte läßt sich aufgrund des bisher Gesagten nur trivial lösen: Gedächtnis-Prozesse sind mit keiner der dargestellten Methoden direkt beobachtbar. Die chemische Manipulation aber scheint zumindest einen Ausweg zu bieten: Sie ermöglicht eine nachträgliche Identifikation einzelner Prozess-Phasen. Werden diese Querschnitte in geeigneter Weise vorgenommen, dann lassen sich die dazwischenliegenden Abläufe möglicherweise rekonstruieren. | |||
Die Frage nach methodenspezifischen Artefakten ist hier noch sehr uninteressant. Es erscheint mir sinnvoller sie erst nach der Darstellung einiger Forschungsarbeiten und deren Schlußfolgerungen zu bearbeiten. Nicht alles, was beobachtet wird, muß nämlich etwas mit Gedächtnis zu tun haben. | |||
Im Folgenden wird es darum gehen, wie, mithilfe der referierten Methoden, Modelle des Gedächtnisses auf der Grundlage organisierter Neuronennetze konstruiert werden, und welcher Art# diese Modelle sind.<ref>vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie' bezüglich der Unterscheidung Homomorphismen vs. Paramorphismen</ref> | |||
</font> | </font> | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||
Version vom 12. September 2025, 14:17 Uhr
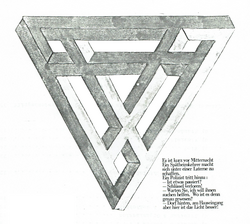
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Überblick
Für einen Neurowissenschaftler entstehen (auf der Basis eines materialistischen Monismus) zunächst eine Reihe von Fragen, die ich vorab in einen Komplex inhaltlicher und einen Komplex methodischer Fragen aufteilen will:
Inhalt
- Von welcher Art sind Veränderungen im Organismus, die sich als Gedächtnis bezeichnen lassen?
- Und: Auf welchem Organisationsniveau ist es sinnvoll, sie zu untersuchen?
- Überhaupt: Wie hat man sich das interne Vokabular, den Code des ZNS vorzustellen?
- Weiterhin: Gibt es verschiedene Gedächtnisse, die den einzelnen Sinnesmodalitäten zugeordnet werden können?
- Oder: Gibt es andere Kriterien, nach denen Arten von Gedächtnis unterschieden werden müssen?
- Schließlich: Gibt es eine spezielle Gedächtnisregion und wo befindet sich dieser 'Seat of Memory'?
Methoden
- Wie lassen sich Phänomene die als mit Gedächtnis assoziiert gedacht werden können, entdecken und beobachten?
- Gibt es eine notwendigen Unterschied zwischen Methoden zur Erfassung von Prozessen, und solchen zur Erfassung von Produkten?
- Gibt es methodenspezifische Artefakte?
Auf die methodischen Fragen will ich gleich hier eingehen, da sie zur Darstellung von Forschungsergebnissen logischerweise als Grundlage notwendig sind. Besondere Beachtung soll dabei den verschiedenen Paradigmen der Beobachtung (i) gelten.
Paradigmen
- Läsionen: Die Methode der Läsionen (= Verletzungen) läßt sich grob in zwei Teilbereiche untergliedern:
Die sogenannten 'split-brain-Experimente' sind die populärsten Vertreter eines Paradigmas in dem die Interaktion verschiedener Gehirnregionen mittels einfachem Durchtrennen ihrer Verbindungen untersucht wird. In einem split-brain-Experiment wird beispielsweise der 'corpus callosum' (der 'Balken'), ein dickes Bündel von Axonen welches die beiden Gehirnhemisphären verbindet, durchtrennt. Dadurch werden eine Reihe von Konsequenzen auf der Verhaltensebene sichtbar die dann wiederum Rückschlüsse auf Vorgänge im zellulären Bereich ermöglichen.
Analog dazu läßt sich die Bedeutung einzelner Regionen oder Strukturen untersuchen. Sie werden (meist) auf operativem Wege entfernt ('surgical removal') was auch wieder Folgen auf der Verhaltensebene zeigt etc...!
- Pathologie: Der Bereich Pathologie ist eng mit dem der Läsionen verknüpft. Läsions-Experimente am Menschen sind ethisch durch nichts zu rechtfertigen, und so ist hier das Ergebnis von Unfällen, Krankheiten und dadurch notwendig gewordener Eingriffe Gegenstand der Untersuchungen. Sehr starken Auftrieb erfuhr dieses Vorgehen während des Ersten Weltkrieges, wo Tausende von Gehirnverletzungen studiert werden konnten.
Als Zyniker würde man dieser Methode wohl den Leitsatz "Wat dem eenen sin Uhl ..." unterstellen, was aber bestimmt nur einen ganz kleinen Teil der Wahrheit wiedergibt!
- alterungsbedingte Veränderungen: Wenn man annimmt, daß Lernvorgänge keine Einzelerscheinungen sind, sondern im Rahmen einer ständigen Veränderung des gesamten Organismus betrachtet werden müssen, dann liegt der Schluß nahe, alterungsbedingte Veränderungen im ZNS als Effekte von Lernprozessen anzusehen. Diese Methode ist im Unterschied zu den beiden vorigen eher geeignet, Vorgänge im molekularen Bereich zu untersuchen.
- chemische Manipulationen: Dieses Paradigma zielt ebenfalls auf Vorgänge in molekularen Größenordnungen. Bei der Suche nach manifesten Veränderungen durch Lernvorgänge werden beispielsweise proteinsynthesehemmende Substanzen verabreicht, um festzustellen, ob der Metabolismus (spezieller) Proteine mit der Bildung permanenter Spuren zusammenhängt.
Chemische Manipulationen können auch als (unblutige) Ergänzung zur Läsionsmethode (s.o.) gesehen werden: Mit speziellen Chemikalien ist es möglich, die Funktion ganzer Bereiche lahmzulegen ('spreading-depression-technique'). Dadurch lassen sich deren Ausfälle untersuchen, ohne sie operativ zu entfernen. Da dieses Vorgehen nicht zu irreversiblen Schädigungen führt, ermöglicht es darüberhinaus die Untersuchung von Ausfällen spezifischer Strukturen im menschlichen ZNS.
- 'single-unit-recording' & 'stimulation technique': Vorgänge auf zellulärem Niveau schließlich lassen sich untersuchen, indem man die elektrische Aktivität eng beieinander liegender oder sogar einzelner Zellen beobachtet. Dies kann auf zweierlei Arten erfolgen:
Die Aktivität kann mittels direkt in die interessierende Region eingeführten 'Mikroelektroden' registriert und aufgezeichnet werden. Diese Methode wird als 'single-unit-recording' bezeichnet. Bei den zum Teil sehr weitreichenden und komplexen Verschaltungen ist es damit jedoch nur begrenzt möglich, etwas über die Funktion bestimmter Zellgruppen auszusagen. Der Anwendungsbereich dieser Methode liegt deshalb eher in der Untersuchung kleiner 'überschaubarer' Nervensysteme, wie etwa dem des Octopus, der Biene oder der Schnecke.
Benutzt man die Umkehrung dieser Methode ('stimulation technique') als Ergänzung, kann man zu Aussagen kommen, deren Form derjenigen logischer Sätze von der Art 'genau dann wenn ...' entspricht:
"Zeigt ein Organismus%X das Verhalten%Y, dann sind Neuronen der Region%Z in charakteristischer Weise aktiv. Werden die Neuronen der Region%Z durch externe elektrische Impulse stimuliert, dann zeigt der Organismus%X das Verhalten%Y«."#
.in0[1]Unabhängig von dieser nach verschiedenen Zugangsweisen gefundenen Anordnung existieren weitere Kriterien die eine Charakterisierung der Methode ermöglichen. Eines, das in diesem Kontext noch von Interesse sein wird, ist die Unterscheidung von Experimenten 'in vitro' vs. 'in vivo'. In vivo drückt aus, daß Vorgänge im lebenden Organismus studiert werden. Entsprechend weist 'in vitro' auf die Untersuchung isolierter Gewebeteile hin, die sich gewöhnlich in einem Millieu befinden, in dem sie für einige Zeit noch als lebend bezeichnet werden können.
Die Frage nach Unterscheidung von Methoden zur Untersuchung von Prozessen und solchen für Produkte läßt sich aufgrund des bisher Gesagten nur trivial lösen: Gedächtnis-Prozesse sind mit keiner der dargestellten Methoden direkt beobachtbar. Die chemische Manipulation aber scheint zumindest einen Ausweg zu bieten: Sie ermöglicht eine nachträgliche Identifikation einzelner Prozess-Phasen. Werden diese Querschnitte in geeigneter Weise vorgenommen, dann lassen sich die dazwischenliegenden Abläufe möglicherweise rekonstruieren.
Die Frage nach methodenspezifischen Artefakten ist hier noch sehr uninteressant. Es erscheint mir sinnvoller sie erst nach der Darstellung einiger Forschungsarbeiten und deren Schlußfolgerungen zu bearbeiten. Nicht alles, was beobachtet wird, muß nämlich etwas mit Gedächtnis zu tun haben.
Im Folgenden wird es darum gehen, wie, mithilfe der referierten Methoden, Modelle des Gedächtnisses auf der Grundlage organisierter Neuronennetze konstruiert werden, und welcher Art# diese Modelle sind.[2]
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann