Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Vorwort: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC}} | ||
Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung, dem Thema der vorliegenden Arbeit, lassen sich in vielerlei Hinsicht Überlegungen anstellen. Trotz vierer Bestimmungsstücke (Modell-Bildung, Gedächtnis-Forschung) sind der Auswahl von Inhalten sowie von Methoden zur Bearbeitung derselben keine Grenzen gesetzt, die eine Bearbeitung des Themas in einem vertretbaren Rahmen garantieren würden. Dies hat vor allem einen Grund: Zwei Bestimmungsstücke des Themas sind nicht eindeutig! | |||
Da ist z.B. das Gedächtnis: Vorausgesetzt, es herrscht Einigkeit über die Bedeutung des Terms 'Forschung', dann ist Gedächtnisforschung Bestandteil mehrerer Disziplinen: | |||
Die Psychologie betreibt neben der Suche nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten auch eine Erforschung der zugehörigen Entwicklungsprozesse sowie deren Besonderheiten im interindividuellen Vergleich. | |||
Eine ähnliche Betonung erfährt die Gedächtnisforschung in der Biologie. Dort liegt das Interesse näher bei direkt beobachtbaren Vorgängen, bzw. bei den Produkten dieser Vorgänge. | |||
Auch die Immunologie bedient sich eines Gedächtnisbegriffs. | |||
Wie sonst sollten die, als aktive Immunisierung bezeichneten, | |||
Folgen zurückliegender Infektionen plausibel gemacht werden. | |||
Selbst im Bereich der bisher totgeglaubten Mineralien existiert ein Begriff von Gedächtnis. Dieser ist warscheinlich der exotischste von allen: Gemeint sind nicht die programmierbaren Siliziumkristalle, die schon seit einigen Jahren als Speicherelemente für Systeme der Informationsverarbeitung dienen; gemeint sind bestimmte Metallegierungen, die sich unter geeigneten Bedingungen von selbst verformen, wobei sie eine Gestalt annehmen, die sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatten. | |||
Der Informationsfluß, d.h. die Zusammenarbeit zwischen diesen Disziplinen bei der Erforschung des gemeinsamen Interessenfeldes ist allerdings dank kaum zu überwindender Fakultätsgrenzen so niedrig, daß eine gegenseitige Befruchtung der wissenschaftlichen Arbeit als sehr unwarscheinlich angenommen werden muß. | |||
Vor allem die Psychologie zeigt ein bemerkenswert geringes Interesse an Erkenntnissen anderer Disziplinen. Das liegt mit einiger Sicherheit am gebrochenen Verhältnis dieser Wissenschaft zum Ursprung ihres Namens. | |||
Das zweite Bestimmungsstück mit mangelnder Eindeutigkeit ist der Term 'Modell'. Vorausgesetzt, daß hier über den Inhalt von 'Bildung' weitgehende Einigkeit herrscht, können mit 'Modellbildung' mehrere Aktivitäten gemeint sein: | |||
Nachbildung eines Prinzips mittels mechanischer und/oder elektronischer Elemente, Abbildung mittels formal-logischer Konstruktionen, Abstraktionen, Idealisierungen und dergleichen mehr. | |||
Einer Klärung bedürfen außerdem die Beziehungen innerhalb der folgenden Begriffspaare: Modell/Theorie, Modell/Analogie, und Modell/Metapher. | |||
Die Auswahl aus dem eben dargelegten Angebot möglicher Interpretationen des Themas basiert selbstverständlich auf der Grundlage einer Problemstellung. Deren Ableitung will ich nun kurz skizzieren. | |||
Das Thema der Arbeit ist insofern beliebig als der Ausgangspunkt weder beim Gedächtnis noch noch bei der Modellbildung zu finden ist. Stattdessen geht es mir primär um die Frage der prinzipiellen Brauchbarkeit von Forschungsstrategien. | |||
Zu diesem Zweck bediene ich mich einer Methode, die ich hier als wissenschaftstheoretische Feldstudie bezeichnen möchte. Als Feldstudie wird eine Strategie bezeichnet, die sich (a) keines Labors und (b) keiner experimentellen Manipulation bedient. Diese Methode ist angezeigt, wenn in den zu untersuchenden Zusammenhang nicht eingegriffen werden kann oder nicht eingegriffen werden darf; sie wird deshalb auch als nichtreaktive Methode bezeichnet. | |||
Wie für jede Untersuchung bedarf es auch hier mindestens zweier Beobachtungseinheiten, einer gemeinsamen Aktivität derselben und eines Bewertungsmaßstabs für diese Aktivitäten. Auf diese Weise kann man zu vielen verschiedenen Themen kommen, von denen eines nun das Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist: | |||
Untersuchungseinheiten mit teils stark divergierenden Erkenntnismethoden sind hier Psychologie und Biologie. | |||
Eine Aktivität, die beiden gemeinsam ist, gilt der Erforschung des Gedächtnisses lebender Organismen. | |||
Die Bewertung dieser Forschungsaktivitäten beschränkt sich auf die darin vorfindbaren Modelle. Diese werden hinsichtlich mehrerer Aspekte mit einem zuvor festgelegten Modellbegriff verglichen. Die Festlegung geschieht innerhalb des Entwurfs einer Forschungsstrategie bei der die Rekonstruktion verborgener Mechanismen im Zentrum des Interesses steht. | |||
Die praktische Durchführung der Untersuchung gestaltet sich nun folgendermaßen: | |||
Das erste Kapitel dient der Klärung einiger Begriffe die zur Darstellung der dann folgenden Ausführungen immer wieder (auch implizit) benötigt werden. | |||
Neben Gedächtnis und Modell sind das die Begriffspaare Leib & Seele und Struktur & Organisation. | |||
Das zweite Kapitel befaßt sich mit den Wurzeln der Gedächtnisforschung und zwar aus zwei Perspektiven: | |||
Zum einen wird versucht, die Geschichte sogenannter Wie-Fragen und deren Beantwortung nachzuzeichnen. | |||
Zum anderen geht es um die Anfänge der Messung von Gedächtnisphänomenen unter dem Etikett 'Wieviel?'. | |||
Diesen Darstellungen folgt ein Exkurs, mit dem Ziel die Beziehung von Psychologie und Biologie zu klären. | |||
Als weiteres begriffliches Werkzeug soll in diesem Kontext ein Systembegriff eingefürt werden. | |||
Aufbauend auf diesen Vorarbeiten folgt dann die Untersuchung der konkreten Modelle. Die Bewertung derselben folgt dabei unmittelbar ihrer Beschreibung. | |||
Das dritte Kapitel nun beschreibt einige Beispiele biologischer Gedächtnisforschung. | |||
Nach einführenden Bemerkungen zu Fragestellungen, Paradigmen usw. konzentrieren sich die Ausführungen auf die Aspekte des 'Wie' und des 'Wo' von Gedächtnis. | |||
Das vierte Kapitel beginnt in ähnlicher Weise wie das vorhergehende; in seinem inhaltlichen Teil muß aber dem Theorienpluralismus in der Psychologie verstärkt Rechnung getragen werden. | |||
Neben den Aspekten 'Prozess' und 'Organisation' sollen daher auch Ansätze zur Integration dieser beiden Bereiche untersucht werden. | |||
Die Verarbeitung der bis dahin erhobenen Daten erfolgt in einer einfachen Zusammenstellung derselben, d.h. deskriptiv. | |||
Nach Möglichkeit soll ein Vergleich disziplinspezifischer Modellcharakteristika hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit dem zugrundegelegten Modellbegriff geleistet werden. | |||
Die übriggebliebenen offenen Fragen und Probleme dienen als Grundlage eines Ausblicks. Dabei soll versucht werden, grundlegende Fragen im Kontext der Erforschung von Phänomenen lebender Organismen anzuschneiden. | |||
</font> | </font> | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||
Version vom 6. September 2025, 18:53 Uhr
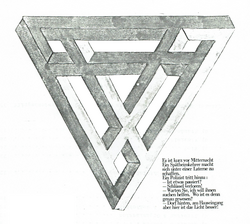
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung, dem Thema der vorliegenden Arbeit, lassen sich in vielerlei Hinsicht Überlegungen anstellen. Trotz vierer Bestimmungsstücke (Modell-Bildung, Gedächtnis-Forschung) sind der Auswahl von Inhalten sowie von Methoden zur Bearbeitung derselben keine Grenzen gesetzt, die eine Bearbeitung des Themas in einem vertretbaren Rahmen garantieren würden. Dies hat vor allem einen Grund: Zwei Bestimmungsstücke des Themas sind nicht eindeutig!
Da ist z.B. das Gedächtnis: Vorausgesetzt, es herrscht Einigkeit über die Bedeutung des Terms 'Forschung', dann ist Gedächtnisforschung Bestandteil mehrerer Disziplinen:
Die Psychologie betreibt neben der Suche nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten auch eine Erforschung der zugehörigen Entwicklungsprozesse sowie deren Besonderheiten im interindividuellen Vergleich.
Eine ähnliche Betonung erfährt die Gedächtnisforschung in der Biologie. Dort liegt das Interesse näher bei direkt beobachtbaren Vorgängen, bzw. bei den Produkten dieser Vorgänge.
Auch die Immunologie bedient sich eines Gedächtnisbegriffs. Wie sonst sollten die, als aktive Immunisierung bezeichneten, Folgen zurückliegender Infektionen plausibel gemacht werden.
Selbst im Bereich der bisher totgeglaubten Mineralien existiert ein Begriff von Gedächtnis. Dieser ist warscheinlich der exotischste von allen: Gemeint sind nicht die programmierbaren Siliziumkristalle, die schon seit einigen Jahren als Speicherelemente für Systeme der Informationsverarbeitung dienen; gemeint sind bestimmte Metallegierungen, die sich unter geeigneten Bedingungen von selbst verformen, wobei sie eine Gestalt annehmen, die sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatten.
Der Informationsfluß, d.h. die Zusammenarbeit zwischen diesen Disziplinen bei der Erforschung des gemeinsamen Interessenfeldes ist allerdings dank kaum zu überwindender Fakultätsgrenzen so niedrig, daß eine gegenseitige Befruchtung der wissenschaftlichen Arbeit als sehr unwarscheinlich angenommen werden muß.
Vor allem die Psychologie zeigt ein bemerkenswert geringes Interesse an Erkenntnissen anderer Disziplinen. Das liegt mit einiger Sicherheit am gebrochenen Verhältnis dieser Wissenschaft zum Ursprung ihres Namens.
Das zweite Bestimmungsstück mit mangelnder Eindeutigkeit ist der Term 'Modell'. Vorausgesetzt, daß hier über den Inhalt von 'Bildung' weitgehende Einigkeit herrscht, können mit 'Modellbildung' mehrere Aktivitäten gemeint sein:
Nachbildung eines Prinzips mittels mechanischer und/oder elektronischer Elemente, Abbildung mittels formal-logischer Konstruktionen, Abstraktionen, Idealisierungen und dergleichen mehr.
Einer Klärung bedürfen außerdem die Beziehungen innerhalb der folgenden Begriffspaare: Modell/Theorie, Modell/Analogie, und Modell/Metapher.
Die Auswahl aus dem eben dargelegten Angebot möglicher Interpretationen des Themas basiert selbstverständlich auf der Grundlage einer Problemstellung. Deren Ableitung will ich nun kurz skizzieren.
Das Thema der Arbeit ist insofern beliebig als der Ausgangspunkt weder beim Gedächtnis noch noch bei der Modellbildung zu finden ist. Stattdessen geht es mir primär um die Frage der prinzipiellen Brauchbarkeit von Forschungsstrategien.
Zu diesem Zweck bediene ich mich einer Methode, die ich hier als wissenschaftstheoretische Feldstudie bezeichnen möchte. Als Feldstudie wird eine Strategie bezeichnet, die sich (a) keines Labors und (b) keiner experimentellen Manipulation bedient. Diese Methode ist angezeigt, wenn in den zu untersuchenden Zusammenhang nicht eingegriffen werden kann oder nicht eingegriffen werden darf; sie wird deshalb auch als nichtreaktive Methode bezeichnet.
Wie für jede Untersuchung bedarf es auch hier mindestens zweier Beobachtungseinheiten, einer gemeinsamen Aktivität derselben und eines Bewertungsmaßstabs für diese Aktivitäten. Auf diese Weise kann man zu vielen verschiedenen Themen kommen, von denen eines nun das Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist:
Untersuchungseinheiten mit teils stark divergierenden Erkenntnismethoden sind hier Psychologie und Biologie.
Eine Aktivität, die beiden gemeinsam ist, gilt der Erforschung des Gedächtnisses lebender Organismen.
Die Bewertung dieser Forschungsaktivitäten beschränkt sich auf die darin vorfindbaren Modelle. Diese werden hinsichtlich mehrerer Aspekte mit einem zuvor festgelegten Modellbegriff verglichen. Die Festlegung geschieht innerhalb des Entwurfs einer Forschungsstrategie bei der die Rekonstruktion verborgener Mechanismen im Zentrum des Interesses steht.
Die praktische Durchführung der Untersuchung gestaltet sich nun folgendermaßen:
Das erste Kapitel dient der Klärung einiger Begriffe die zur Darstellung der dann folgenden Ausführungen immer wieder (auch implizit) benötigt werden.
Neben Gedächtnis und Modell sind das die Begriffspaare Leib & Seele und Struktur & Organisation.
Das zweite Kapitel befaßt sich mit den Wurzeln der Gedächtnisforschung und zwar aus zwei Perspektiven:
Zum einen wird versucht, die Geschichte sogenannter Wie-Fragen und deren Beantwortung nachzuzeichnen.
Zum anderen geht es um die Anfänge der Messung von Gedächtnisphänomenen unter dem Etikett 'Wieviel?'.
Diesen Darstellungen folgt ein Exkurs, mit dem Ziel die Beziehung von Psychologie und Biologie zu klären.
Als weiteres begriffliches Werkzeug soll in diesem Kontext ein Systembegriff eingefürt werden.
Aufbauend auf diesen Vorarbeiten folgt dann die Untersuchung der konkreten Modelle. Die Bewertung derselben folgt dabei unmittelbar ihrer Beschreibung.
Das dritte Kapitel nun beschreibt einige Beispiele biologischer Gedächtnisforschung.
Nach einführenden Bemerkungen zu Fragestellungen, Paradigmen usw. konzentrieren sich die Ausführungen auf die Aspekte des 'Wie' und des 'Wo' von Gedächtnis.
Das vierte Kapitel beginnt in ähnlicher Weise wie das vorhergehende; in seinem inhaltlichen Teil muß aber dem Theorienpluralismus in der Psychologie verstärkt Rechnung getragen werden.
Neben den Aspekten 'Prozess' und 'Organisation' sollen daher auch Ansätze zur Integration dieser beiden Bereiche untersucht werden.
Die Verarbeitung der bis dahin erhobenen Daten erfolgt in einer einfachen Zusammenstellung derselben, d.h. deskriptiv.
Nach Möglichkeit soll ein Vergleich disziplinspezifischer Modellcharakteristika hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit dem zugrundegelegten Modellbegriff geleistet werden.
Die übriggebliebenen offenen Fragen und Probleme dienen als Grundlage eines Ausblicks. Dabei soll versucht werden, grundlegende Fragen im Kontext der Erforschung von Phänomenen lebender Organismen anzuschneiden.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann