Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Synapsen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984}} <font size="3" face="Gothic"> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 3}} </font> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}}“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 3}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 3}} | ||
;Synapsen | |||
Die Vorstellung, daß die Bildung von Gedächtnisspuren in einer Verbesserung synaptischer Übertragungseigenschaften bestünde, ist in etwas trivialisierter Form schon in der Theorie des atomistischen Assoziationismus# zu finden. Dieser Theorie lag<ref>vgl. Kap.2: 'Wie?'</ref> | |||
eine einfache Reflex-Metapher zugrunde, was in der Hauptsache zwei Konsequenzen hatte: | |||
#Durch die Analogie eines Reflexbogens muß für jedes Verhalten ein Auslöser angenommen werden. Dies führt zu einem sehr eingeschränkten Gedächtnisbegriff<ref>selbst bei Zugrundelegung des von mir in Kap.1 definierten Gedächtnisbegriffs muß der hier verwendete als stark eingeschränkt bezeichnet werden, da er sich plausibel nur auf Verhaltensmuster anwenden läßt. Für die Repräsentation von Information im ZNS ist er gänzlich unbrauchbar.</ref> der sich nur | |||
mit einer Anzahl zusätzlicher Prämissen über die Paradigmen klassischer bzw. operanter Konditionierung hinaus generalisieren | |||
läßt. | |||
#Die Reduktion aller höheren geistigen Prozesse auf (Kombinationen von) Reflexe(n) führte zur Position des Behaviorismus# (präziser: reduktiver materialistischer Monismus).<ref>vgl. Kap.1: 'Leib & Seele'</ref> Danach sind interne Optimierung, Reflexion und sonstige Vorgänge, die unabhängig von der unmittelbar extern gegebenen Reizkonstellation ablaufen können, nur mittels großartiger Verrenkungen intellektueller Natur erklärbar. Damit aber führt sich diese Position selbst ad absurdum. | |||
Der atomistische Assoziationismus bzw. der Behaviorismus als dessen 'Nachfolger' ist ein Beispiel dafür, wie eine Idee durch vorschnelle und schlecht fundierte Verallgemeinerungen in eine Sackgasse manövriert werden kann. Die Konsequenz einer solchen Entwicklung besteht meist in einer Stagnation des gesamten Forschungsbetriebs, als Folge einer zeitaufwendigen Überprüfung der empirisch-logischen Struktur des gesamten Theoriegebäudes. | |||
Zwei Grundannahmen der behavioristischen Position haben eine derartige Revision, falls sie tatsächlich stattgefunden haben sollte, unbeschadet überstanden. Einige experimentelle Befunde, die dies belegen will ich kurz referieren. | |||
Daß die Reizübertragung an Synapsen veränderbar ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in Zweifel gezogen werden. B. LIBET, H. KOBAYASHI und T. TANAKA haben diese Variabilität beschrieben, und die damit zusammenhängenden biochemischen Vorgänge untersucht:<ref>vgl. Libet,B., Kobayashi,H., Tanaka,T. (1975): Synaptic Coupling into the Production and Storage of a Neural Memory Trace.</ref> Ihre Zellpopulation bestand im oberen sympathischen Halsganglion eines Kaninchens. Untersucht wurde es in vitro bei 22%~C und umspült mit 1%ml/min Krebs-Ringer-Lösung. Daß die Zellen noch funktionsfähig waren, wurde durch Gabe von Acetyl-ß-methylcholin (MCh), was eine leichte Depolarisation zur Folge hatte, bestätigt. Eine weitere Vorbehandlung mit dem Wirkstoff 'Bethanechol' stellte sicher, daß kein wirksames Dopamin (DA) mehr im Ganglion enthalten war. | |||
Ausgangspunkt der Untersuchung war ein Ergebnis früherer Experimente: DA, selbst ein Transmitter, führt in cholinergen Synapsen zu einer langanhaltenden Erhöhung der postsynaptisch durch Acetylcholin (ACh) erzeugten Depolarisation. | |||
L,%K%&%T untersuchten den Einfluß einer weiteren Substanz auf diesen Prozess - statt ACh verwendeten sie aber das oben erwähnte MCh: Gibt man zyklisches Guanosinmonophosphat (cGMP) in einer Konzentration von 5•10+¦%Mol für ein Dauer von 8 Minuten der Krebs-Ringer-Lösung zu, dann kann der Effekt des DAs verhindert werden. Diese Wirkung stellte sich auch dann noch ein, wenn der Beginn der cGMP-Zugabe bis zu 4%Minuten nach der Injektion des DAs lag. Ein Effekt auf nachfolgende Injektionen von DA wurde nicht beobachtet. | |||
Die Wirkung von cGMP-ähnlichen Substanzen wie GMP (nicht-zyklisch), cAMP (zyklisches Adenosinmonophosphat) und AMP war unbedeutend oder gleich Null, ebenso wie eine Zugabe von 10%mMol%K« zur Krebs-Ringer-Lösung. | |||
Wurde die Zugabe von cGMP um mehr als 4%Minuten verzögert, zeigte sich eine deutliche Verringerung des Störeffekts, der nach 10-15%Minuten vollständig verschwunden war. | |||
Diese Befunde legen eine Art Speicher-Prozess nahe, der innerhalb der kritischen Zeit von 10-15%Minuten abläuft, und eine Stabilisierung des DA-Effekts zur Folge hat. | |||
In einer Folge weiterer Experimente sammeln L,%K%&%T Hinweise auf die einzelnen biochemischen Zwischenschritte dieses Konsolidierungsprozesses. Im Rahmen dieses Abschnitts genügt es aber festzuhalten, daß eine chemische Synapse mittels ihrer biochemischen Dynamik in der Lage ist, ihre Übertragungseigenschaften zu ändern. | |||
Die zweite Annahme des Behaviorismus, die in einer Anwendung des eben Gesagten auf den Erwerb von Verhaltenmustern besteht, kann sich ebenfalls auf ein solides empirisches Fundament stützen: | |||
In kleinen, relativ überschaubaren<ref>der Ausdruck 'überschaubar' ist tatsächlich relativ zu verstehen. Selbst kleine Nervensysteme können aus bis zu einer Million Neuronen bestehen. Es besteht also kein Anlaß, sich ein kleines NS als besonders primitiv vorzustellen.</ref> Nervensystemen können die Effekte beispielsweise von klassischer Konditionierung am veränderten Reaktionsverhalten bestimmter Nervenzellen identifiziert werden. | |||
Mit den neuronalen Entsprechungen des Lernens im Nervensystem der Honigbiene hat sich Joachim ERBER<ref>vgl. Erber,J.: Neural Correlates of Learning in the Honeybee.</ref> beschäftigt. In einer Einschätzung seiner Ergebnisse stellt er fest daß: | |||
"It is remarkable that the response changes which occur in interneurones during sensitization or conditioning show such a close similarity to the modifications observed in behavioral studies. In this respect, results in bees are similar to those obtained from molluscs and crustaceans." | |||
Ähnlich wie der Plastizitäts-Ansatz geht auch ERBER von einer empirisch vorgefundenen Parallelität von Verhalten und internen Prozessen aus. Zu zeigen bleibt deshalb auch hier wieder, durch welche kausalen oder modalen Transformationen die Phänomene der Verhaltensebene in die, der zellulären übersetzt werden können und vice versa. ERBER hat dazu mit seinen Honigbienen drei Lernexperimente durchgeführt währenddenen er die elektrische Aktivität verschiedener Neurone mittels intrazellulärer Ableitung registrierte: | |||
#Geruchskonditionierung Der Biene werden der Geruch von Zuckerwasser und, an einem Fühler, ein Tropfen Zuckerwasser dargeboten. Fährt sie daraufhin ihren Rüssel aus, wird sie mit einem weiteren Tropfen Zuckerwasser belohnt. Bereits im nächsten Durchgang genügt der Duft damit die Biene ihren Rüssel ausfährt. | |||
#Bewegungskonditionierung Die Stimulation der Fühler mittels Zuckerwasser und ein aufwärts bewegtes schwarz-weißes Streifenmuster werden gleichzeitig dargeboten. Reagiert die Biene mit den Fühlern, wird sie mit Zuckerwasser belohnt. Nach fünf bis zehn Durchgängen reicht das bewegte Muster für diese Reaktion aus. | |||
#Sensibilisierung oder nichtassoziatives Lernen Wird den Fühlern Zuckerwasser dargeboten, dann steigt in der Folge die Warscheinlichkeit, daß Stimulation der Fühler mit Wasserdampf zum Ausfahren des Rüssels führt. Außerdem ist die Reaktion der Fühler auf ein senkrecht bewegtes, schwarz-weißes Streifenmuster in richtungsabhängiger Weise verändert. | |||
Als zentrale Instanz seiner Interpretationen dienen ERBER die multimodalen Neuronen. Grundannahme ist dabei, daß in diesen Neuronen verschiedene Modalitäten 'integriert' werden können, was sich auf der Verhaltensebene als Lernen bezeichnen läßt. Dies gilt sowohl für assoziatives als auch für nichtassoziatives Lernen; die Unterscheidung liegt allein in der zeitlichen Relation der Reize. | |||
Neuronale Entsprechungen konnten für assoziatives wie für nichtassoziatives Lernen gefunden werden: | |||
*Zellen im Protocerebrum, die auf Zuckerwasser-Stimulation des Rüssels reagieren, steigern ihre Geruchs-Empfindlichkeit (Fühler) während des Konditionierens (i). Ein Empfindlichkeitszuwachs für andere Modalitäten lag nicht vor; | |||
*bewegungssensible Neuronen mit Projektionen ins Protocerebrum verändern ihr Antwortverhalten während des Konditionierens mit der Anzahl der Belohnungen (ii). Auch diese sind multimodal und reagieren auf Geruch, mechanische Reizung und Zuckerwasser. | |||
*von mehreren hundert untersuchten bewegungssensiblen Neuronen im Protocerebrum reagierten 75%Prozent auf mehr als eine Modalität. Nach einer Zuckerwasserstimulation zeigten wiederum einige dieser Zellen spezifische Änderungen im Antwortverhalten auf den Bewegungsreiz. | |||
Von ähnlichen Experimenten mit gleicher Zielrichtung berichtete eine Forschergruppe 1982 in der Zeitschrift SCIENCE.<ref>Carew,T.J., Hawkins,R.D., Kandel,E.R. (1982): Differential Classical Conditioning of a Defensive Withdrawal-Reflex in Aplysia Californica. Hawkins,R.D., Abrams,T.W., Carew,T.J., Kandel,E.R. (1982): A Cellular Mechanism of Classical Conditioning in Aplysia. Walters,E.T. & Byrne,J.H. (1982): Associative Conditioning of Single Sensory Neurons.</ref> Ihr Versuchstier war eine Nacktschnecke mit Namen Aplysia californica. | |||
Der Defensivreflex dieses Tieres ist durch einen gut erforschten neuronalen Schaltkreis vermittelt. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Effekte verschiedener Konditionierungsprozeduren mit diesem Reflex als CR, auf das Verhalten der beteiligten Neuronen zu studieren. | |||
Um die Redundanz innerhalb dieses Kapitels nicht noch mehr zu erhöhen, genügt es, festzuhalten, daß der Erwerb von Verhaltensweisen %a%u%c%h% bei Aplysia californica sehr warscheinlich mit Veränderungen im Antwortverhalten spezieller Synapsen zusammenhängt. | |||
In gewisser Weise ist ein Gedächtnismodell, welches auf diesen Tatsachen basiert, eine Synthese der beiden zuvor dargestellten Ansätze: | |||
Da die Reizübertragung vorwiegend mittels chemischer Synapsen vonstatten geht, besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse aus dem Peptid-Ansatz unter neuen Prämissen zu diskutieren. Andererseits ist hier auch der Plastizitäts-Ansatz hier wiederzufinden: Die graduelle Veränderung des synaptischen Widerstands stellt in dieser Hinsicht eine Verfeinerung des grobschlächtigen 'Alles-oder-Nichts-Prinzips' beim synaptischen Turnover dar. | |||
Gleichzeitig mit der Expandierung des Referenzbereichs dieses Modells auf die Repräsentation von Wissen innerhalb des Organismus verläßt man den Bereich der offen beobachtbaren Mechanismen: Die Konstruktion von Paramorphismen ist indiziert. Zwei der dabei denkbaren und realisierten Vorgehensweisen will ich jetzt referieren. | |||
Eine Forschergruppe, die sich ausschließlich auf chemische Methoden<ref>vgl. 'Paradigmen' in Abschnitt a) dieses Kapitels</ref> stützt, hat Ende der siebziger Jahre eine Reihe von Arbeiten veröffentlicht, die sich allesamt mit Gedächtnismechanismen befassen.<ref>Gibbs,M.E. & Ng,K.T. (1976): Memory Formation: A New Three-Phase-Model. Gibbs,M.E. & Ng,K.T. (1977): Psychobiology of Memory: Towards a Model of Memory Formation. Gibbs,M.E., Gibbs,C.L., Ng,K.T. (1978): A Possible Physiological Mechanism for Short-Term Memory.</ref> Bemerkenswert erscheint mir dabei die Betrachtung von permanentem Gedächtnis im Rahmen und als Konsequenz eines umfassend angelegten biochemischen Prozesses. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit zwar völlig unerheblich, trägt andererseits aber wesentlich zur Plausibilität dieses Ansatzes bei. | |||
Wie die Autoren selbst zugestehen, sind Prozesse von nicht-chemischer Natur mit ihrem Paradigma nicht beobachtbar, was den Geltungsbereich des Ansatzes letzendlich im Unklaren läßt. Über die Prämisse, daß nur die unmittelbar am Beginn anzusiedelnden Prozesse elektrischer Natur sind, können intermittierende nicht-chemische Abläufe vorläufig ausgeschlossen werden. | |||
Das Paradigma setzt sich aus zwei Teilen zusammen: | |||
#besteht in der Konditionierung eines passiven Vermeidungsverhaltens. Einen Tag alte männliche Küken werden trainiert, nach einem 4%mm großen verchromten Kügelchen zu picken. Ist das erreicht, wird das Kügelchen mit einer aversiven Substanz beschichtet. Weigern sich die Küken in der Folge, nach einem gleichen, aber unbeschichteten Kügelchen zu picken, ist das passive Vermeidungsverhalten gelernt. | |||
#Die chemische Manipulation bestand im Verabreichen verschiedener Drogen, die im Verdacht stehen, den Gedächtnisprozess an bestimmten Stellen abzubrechen. Die Verabreichung geschah mittels intracranialer Injektionen von jeweils 10+¦%l pro Hemisphäre. Nach diesen Injektionen wurde dann der Effekt auf das Vermeidungsverhalten geprüft. | |||
Aufgrund ihrer Ergebnisse schlagen GIBBS%&%NG ein sequentielles Drei-Phasen-Modell der Gedächtnisbildung<ref>Wie bereits weiter oben angedeutet, handelt es sich hier 'nur' um biochemische Prozesse. Der Vorschlag eines sequentiellen Drei-Phasen-Modells wird folgerichtig von den Autoren nur als Minimalannahme formuliert.</ref> vor. Dessen dritte Phase bestünde in der Bildung permanenter Spuren. | |||
Zur Illustration der Zusammenhänge gebe schematisch das ganze Modell wieder: | |||
Ergebnisse und Folgerungen zu Phase%III des Modells will ich etwas eingehender darstellen: | |||
Die Bildung permanenten Gedächtnisses kann durch die beiden Drogen 'Cycloheximid' (CXM) und 'Anisomycin' behindert werden. Betrachtet man den Verlauf dieses Effektes in Abhängigkeit von dem, zwischen Lernvorgang und Verabreichung verstrichenen, Zeitintervall, dann zeigt sich folgendes: | |||
*die Behaltensleistung innerhalb der ersten 30%Minuten wird kaum berührt. Danach sinkt sie jedoch in auffälliger Weise. Demnach beginnt Phase%III also nach diesem Intervall. | |||
*die maximale Wirksamkeit wird erreicht, wenn die Drogen 5%Minuten vor dem Lernen gegeben werden. Der Verlauf der Behaltensleistung entspricht dann annähernd dem Abklingen von Phase%II. | |||
Berücksichtigt man weiter, daß der Effekt bis zu 72%Stunden nach dem Lernen nicht verschwindet, dann muß angenommen werden, daß es sich dabei eher um eine Behinderung des Lernens als des Erinnerns handelt. Dies führt zu der Frage, welche biochemischen Abläufe eigentlich behindert werden. | |||
Von CXM und Anisomycin ist bekannt, daß sie die Proteinsynthese in den Ribosomen hemmen. Der Effekt von CXM wird durch die Antagonisten Amphetamin, Diphenylhydantoin (DPH) und Noradrenalin (=%Norepinephrin%=%NE) unterlaufen, wenn diese spätestens 30%Minuten nach dem Lernen verabreicht werden. Nach weiteren 180%Minuten (DPH:%60%min) ist dann die Erinnerung fast wieder normal. | |||
DPH unterscheidet sich in einem wichtigen Merkmal von den anderen Antagonisten: Es spielt in der Proteinsynthese des Ribosoms keine Rolle, sein Effekt muß also auf andere Mechanismen zurückführbar sein. Die Hypothese, DPH verlängere die zweite Phase, womit die Zeit bis zum Wiedereinsetzen der Proteinsynthese überbrückt würde, läßt sich durch die Ergebnisse von %G%&%N% bestätigen. | |||
Noch ein weiterer Mechanismus kann durch die Ergebnisse erschlossen werden: | |||
Angenommen, es bestünde eine gegenseitige Abhängigkeit der Na«/K«-Pumpe und des Transports von Aminosäuren durch die Membran. Dann würde DPH nicht nur die zweite Phase verlängern, sondern auch die dritte Phase forcieren, eben weil mehr Aminosäuren transportiert würden. In diesem Fall hätten für die Proteinsynthese nichtmetabolisierbare Aminosäuren denselben Effekt wie CXM, da sie gewissermaßen die Transportwege blockieren würden. Durch DPH müßte dann auch dieser Effekt unterlaufen werden können. | |||
Die Befunde von %G%&%N% lassen auch diese Hypothese als gut bestätigt erscheinen. | |||
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß: | |||
#die ungestörte Proteinsynthese eine notwendige Bedingung für die Enstehung permanenten Gedächtnisses darstellt; | |||
#diese Proteinsynthese in den Neuronen selbst stattfindet; | |||
#die dazu erforderlichen Aminosäuren während des Speicherprozesses durch die Membran in das Neuron hinein geschafft werden müssen; | |||
#dieser Transport mit der Aktivität der Na«/K«-Pumpe gekoppelt ist. | |||
Unter der Überschrift 'Brain Theorie Meets Experiment in Visual Cortex'<ref>Cooper,L.N. & Imbert,M.: Seat of Memory. in: THE SCIENCES Februar 1981, S.10-29</ref> haben Leon N. COOPER, Michel IMBERT und Mitarbeiter versucht, die Informationsrepräsentation in neuronalen Netzwerken (hier speziell im visuellen Cortex) mittels formaler Modelle zu studieren. Unter Verwendung des LASHLEY'schen Konzeptes der 'mass action'<ref>vgl. Kap.2: 'Wie?'</ref> und der Annahme synaptischer Modifikationen konstruierten sie zunächst ein formal-mathematisches Modell. | |||
Im Zuge der Konstruktion dieses Modells machten sie zwei wesentliche Vereinfachungen, die als Idealisierungen begriffen werden können: | |||
*Vollkommen unmöglich ist es (momentan), sämtliche 10¦¦ Neuronen des menschlichen NS in einem solchen Modell zu berücksichtigen. Stellvertretend benutzen %C%&%I% zwei Sätze logischer Einheiten ('units'). Einer diente als Rezeptoräquivalent, der zweite als erste Instanz interner Repräsentation. | |||
*Trotz dieser ersten Restriktion wäre wiederum die Anzahl der vorbildgemäßen Verbindungen zwischen den beiden Sätzen nicht realisierbar gewesen. Unter der Prämisse, daß sich viele Kanäle schlechter Qualität durch einen mit idealem Übertragungsverhalten ersetzen lassen, ist jedes Unit des 'Rezeptors' nur %e%i%n%m%a%l% mit jedem des zweiten Satzes verbunden. | |||
Mit einem Minimalsystem dieser Form läßt sich bereits ein funktionierendes Gedächtnis simulieren. Das Charakteristische überhaupt an dieser Form von Speicherung ist der Kontrast zu zeitgenössischen Computermetaphern: | |||
Die Information ist nicht an einem (!) einzigen Ort und mit Index oder Adresse versehen, sondern weit verstreut, in jeder Synapse ein kleines Stück, festgehalten %-% von 'außen' betrachtet, ist absolut Nichts zu sehen.<ref>Dies erinnert in eindrucksvoller Weise an PRIBRAMs Hologrammtheorie: Bei normaler Beleuchtung ist auf einem Hologramm kein Bild zu erkennen.</ref> | |||
Erinnern ist dann auch nicht als Durchprüfen einer Menge adressierter Speicherpositionen zu denken, sondern aufgrund der Organisation dieses 'Assoziativspeichers', als durch den Inhalt adressierter (vermittelter) Zugang zu der jeweiligen Information.<ref>Formale Modelle dieser Art jedoch ohne Gegenüberstellung empirischer Befunde haben bereits eine gewisse Tradition: Spinelli,D.N. (1970): Occam: A Computer Model for a Content Addressable Memory in the CNS. Die theoretischen Grundlagen solcher Ansätze kann man bereits seit 1909 in den Monographien von Richard Semon nachlesen. vgl. z.B. Semon,R. (1909): Die mnemischen Empfindungen. Evidenzen für einen Zusammenhang zwischen Semons 'Gesetz der Ekphorie' und den Arbeiten von Spinelli bzw. Cooper & Imbert sind allerdings nicht gegeben.</ref> Da sich der Speicherprozess in einem solchen Gedächtnis als simultane Änderung des Antwortverhaltens aller Synapsen darstellt, muß sich mindestens eine Funktion formulieren lassen, die diese Änderung beschreibt. | |||
C%&%I% haben verschiedene derartige Funktionen in ihr Modell eingebaut, um das Verhalten seiner übrigen Eigenschaften herauszufinden. Um die Brauchbarkeit des Modells zu demonstrieren, verglichen sie daraufhin dessen Verhalten mit tatsächlich beobachtbaren Phänomenen im visuellen System von Wirbeltieren. | |||
Untersuchungen des visuellen Systems erwachsener Katzen führten zur Entdeckung orientierungssensitiver Neuronen im visuellen Cortex. Diese reagieren in spezifischer Weise auf Muster, wie Linien oder Kreise, mit bestimmter Bewegungsrichtung. Weitere Untersuchungen zeigten, daß sowohl die Anzahl solcher Zellen als auch deren Antwortverhalten veränderbar ist. | |||
Ihre relative Häufigkeit z.B. hängt in ganz auffälliger Weise mit der visuellen Erfahrung während der ersten sieben bis zehn Lebenswochen zusammen. Während dieser Periode scheint ein Reifeprozess abzulaufen, der sich nach IMBERT und Mitarbeitern in drei Stadien manifestiert: | |||
#Unspezifische Zellen haben kreisrunde rezeptive Felder und reagieren auf runde Objekte mit beliebiger Bewegungsrichtung. | |||
#Unreife Zellen haben ebenfalls große, aber rechteckige rezeptive Felder. Sie reagieren auf sich bewegende Objekte derselben Form wenn diese richtig ausgerichtet sind. | |||
#Spezifische Zellen stellen das Endstadium in dieser Entwicklungsfolge dar. Sie haben ebenfalls rechteckige, aber sehr kleine rezeptive Felder. | |||
Vergleiche zweier Gruppen junger Katzen, von denen die einen in völliger Dunkelheit, die anderen unter normalen Verhältnissen gehalten wurden, zeigten, daß: | |||
*unabhängig von der visuellen Erfahrung, bereits zu Beginn der postnatalen Entwicklung eine gewisse Anzahl spezifischer Zellen vorhanden ist. | |||
*im Alter von 17 bis 70 Tagen die weitere Entwicklung solcher Zellen entscheident durch visuelle Erfahrung stimuliert wird. | |||
*im Gegenzug visuelle Deprivation während dieser Periode zu einem Verlust spezifischer Zellen führt. | |||
*im Alter von 42 Tagen bereits eine sechsstündige visuelle Erfahrung genügt, um das Verhältnis der drei Zelltypen zueinander entscheident zu ändern. | |||
Soweit die, für die Arbeit von %C%&%I% relevanten, Befunde aus dem experimentellen Teil ihres Programms. | |||
Der Theorieteil, auf dem das oben skizzierte formale Modell basiert, stützt sich auf die gut erforschte Anatomie des visuellen Systems. | |||
Die beiden Sätze symbolischer Neuronen ('units') entsprechen dem corpus geniculatum lateralis (seitlicher Kniehöcker) einerseits, und dem visuellen Cortex andererseits. Die mittels verschiedener Funktionen beschriebene Dynamik des synaptischen Antwortverhaltens wird als 'passive SchwellenModifikation' (threshold passive modification) bezeichnet. Danach wird eine Zelle ihre Antwort auf wiederholt dargebotene Stimuli derart ändern, daß sie zunehmend (asymptotisch) auf nur ein Muster mit Erregung antwortet. | |||
Mit diesem Modell haben %C%&%I% drei Fälle visueller Erfahrung durchgespielt und den Antwort-Gradienten der symbolischen Neuronen aufgezeichnet: | |||
#Einfache geometrische Muster hatten den durchschlagendsten Effekt. Fast unabhängig von den Parametern des Modells zeigte sich eine Spezialisierung der Zellen. Selbst Rauschabstände, die beträchtlich unterhalb von 0%dB lagen konnten daran kaum etwas ändern. | |||
#Normale visuelle Stimulation führte ebenfalls zu einer Spezialisierung des Antwortverhaltens: Der Gradient entwickelte sich von einer 'Ebene' zu einem 'Nadelfelsen', d.h. es blieb praktisch nur eine Orientierung auf die das 'Neuron' reagierte. | |||
#Rauschen hatte ganz eindeutig den Verlust der Spezialisierung zur Folge. Dies trat ganz unabhängig von der ursprünglichen Orientierung der Zelle ein und zeigte sich in einem 'abbröckeln' des Antwortmaximums zugunsten der Flanken beider Seiten; allerdings lief dieser Prozess langsamer ab als der Anstieg. Wird, nachdem die Spezialisierung weitgehend verschwunden ist, wieder mit Mustern gearbeitet, beginnen die Zellen sich wieder auf bestimmte Orientierungen zu spezialisieren. Es kann sich dabei um eine völlig andere Richtung handeln als zuvor. | |||
Dieser Fall war außerdem am anfälligsten für eine Variation der Systemparameter. So reagierten die Zellen plötzlich auf Parameter der verwendeten Quasizufallsverteilung der Lichtpunkte (Rauschfunktion). | |||
Die Übereinstimmung von Simulation und experimentellen Befunden ist in einer derart gerafften Darstellung von außerordentlicher Prägnanz. Ich denke, sie bedarf keiner weiteren Ausführungen. | |||
| | synapt.Struk. | 1) Präsynapt. | konditionier- | | |||
| permanentes | ====> | Strukturänder. | ter Reflex | | |||
| (Langzeit-) | Erregbarkeit | | | | |||
| Gedächtnis | spez.Neuronen | 2) selbstopti- | Ökologie: | | |||
| >>Engramme<< | <===> | mierende Spe- | 'Sukzession' | | |||
| | part. Engramm | zialisierung | & 'Klimax' | | |||
Dieser Ansatz enthält bereits soviele selbstständige Bereiche, daß weder die Suche nach Quellen, noch die nach hypothetischen Mechanismen auf Schwierigkeiten stößt. | |||
Seit sich die klassische Konditionierung von einem Modell von Gedächtnis zu einem Modell für Gedächtnis entwickelt hat, liegt der Formulierung existentieller Hypothesen nichts mehr im Wege. | |||
Mehr Probleme schafft da die Annahme einer ökologischen Sukzession als Quelle eines Paramorphismus von Gedächtnis. | |||
Die zuletzt referierten Befunde scheinen dieses Abenteuer wohl zu bestätigen, wobei aber nicht vergessen werden darf, daß auch diese Ergebnisse ganz klar als Anpassungsreaktion auf externe Reizsituationen interpretierbar sind. Es bleibt unklar, wie spezialisierte Neuronen mit Wissensspeicherung in Zusammenhang zu bringen sind. | |||
</font> | </font> | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||
Version vom 19. September 2025, 18:18 Uhr
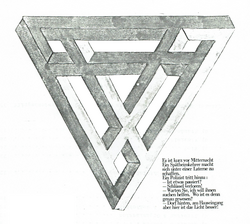
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Synapsen
Die Vorstellung, daß die Bildung von Gedächtnisspuren in einer Verbesserung synaptischer Übertragungseigenschaften bestünde, ist in etwas trivialisierter Form schon in der Theorie des atomistischen Assoziationismus# zu finden. Dieser Theorie lag[1] eine einfache Reflex-Metapher zugrunde, was in der Hauptsache zwei Konsequenzen hatte:
- Durch die Analogie eines Reflexbogens muß für jedes Verhalten ein Auslöser angenommen werden. Dies führt zu einem sehr eingeschränkten Gedächtnisbegriff[2] der sich nur
mit einer Anzahl zusätzlicher Prämissen über die Paradigmen klassischer bzw. operanter Konditionierung hinaus generalisieren läßt.
- Die Reduktion aller höheren geistigen Prozesse auf (Kombinationen von) Reflexe(n) führte zur Position des Behaviorismus# (präziser: reduktiver materialistischer Monismus).[3] Danach sind interne Optimierung, Reflexion und sonstige Vorgänge, die unabhängig von der unmittelbar extern gegebenen Reizkonstellation ablaufen können, nur mittels großartiger Verrenkungen intellektueller Natur erklärbar. Damit aber führt sich diese Position selbst ad absurdum.
Der atomistische Assoziationismus bzw. der Behaviorismus als dessen 'Nachfolger' ist ein Beispiel dafür, wie eine Idee durch vorschnelle und schlecht fundierte Verallgemeinerungen in eine Sackgasse manövriert werden kann. Die Konsequenz einer solchen Entwicklung besteht meist in einer Stagnation des gesamten Forschungsbetriebs, als Folge einer zeitaufwendigen Überprüfung der empirisch-logischen Struktur des gesamten Theoriegebäudes.
Zwei Grundannahmen der behavioristischen Position haben eine derartige Revision, falls sie tatsächlich stattgefunden haben sollte, unbeschadet überstanden. Einige experimentelle Befunde, die dies belegen will ich kurz referieren.
Daß die Reizübertragung an Synapsen veränderbar ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in Zweifel gezogen werden. B. LIBET, H. KOBAYASHI und T. TANAKA haben diese Variabilität beschrieben, und die damit zusammenhängenden biochemischen Vorgänge untersucht:[4] Ihre Zellpopulation bestand im oberen sympathischen Halsganglion eines Kaninchens. Untersucht wurde es in vitro bei 22%~C und umspült mit 1%ml/min Krebs-Ringer-Lösung. Daß die Zellen noch funktionsfähig waren, wurde durch Gabe von Acetyl-ß-methylcholin (MCh), was eine leichte Depolarisation zur Folge hatte, bestätigt. Eine weitere Vorbehandlung mit dem Wirkstoff 'Bethanechol' stellte sicher, daß kein wirksames Dopamin (DA) mehr im Ganglion enthalten war.
Ausgangspunkt der Untersuchung war ein Ergebnis früherer Experimente: DA, selbst ein Transmitter, führt in cholinergen Synapsen zu einer langanhaltenden Erhöhung der postsynaptisch durch Acetylcholin (ACh) erzeugten Depolarisation.
L,%K%&%T untersuchten den Einfluß einer weiteren Substanz auf diesen Prozess - statt ACh verwendeten sie aber das oben erwähnte MCh: Gibt man zyklisches Guanosinmonophosphat (cGMP) in einer Konzentration von 5•10+¦%Mol für ein Dauer von 8 Minuten der Krebs-Ringer-Lösung zu, dann kann der Effekt des DAs verhindert werden. Diese Wirkung stellte sich auch dann noch ein, wenn der Beginn der cGMP-Zugabe bis zu 4%Minuten nach der Injektion des DAs lag. Ein Effekt auf nachfolgende Injektionen von DA wurde nicht beobachtet.
Die Wirkung von cGMP-ähnlichen Substanzen wie GMP (nicht-zyklisch), cAMP (zyklisches Adenosinmonophosphat) und AMP war unbedeutend oder gleich Null, ebenso wie eine Zugabe von 10%mMol%K« zur Krebs-Ringer-Lösung.
Wurde die Zugabe von cGMP um mehr als 4%Minuten verzögert, zeigte sich eine deutliche Verringerung des Störeffekts, der nach 10-15%Minuten vollständig verschwunden war.
Diese Befunde legen eine Art Speicher-Prozess nahe, der innerhalb der kritischen Zeit von 10-15%Minuten abläuft, und eine Stabilisierung des DA-Effekts zur Folge hat.
In einer Folge weiterer Experimente sammeln L,%K%&%T Hinweise auf die einzelnen biochemischen Zwischenschritte dieses Konsolidierungsprozesses. Im Rahmen dieses Abschnitts genügt es aber festzuhalten, daß eine chemische Synapse mittels ihrer biochemischen Dynamik in der Lage ist, ihre Übertragungseigenschaften zu ändern.
Die zweite Annahme des Behaviorismus, die in einer Anwendung des eben Gesagten auf den Erwerb von Verhaltenmustern besteht, kann sich ebenfalls auf ein solides empirisches Fundament stützen:
In kleinen, relativ überschaubaren[5] Nervensystemen können die Effekte beispielsweise von klassischer Konditionierung am veränderten Reaktionsverhalten bestimmter Nervenzellen identifiziert werden.
Mit den neuronalen Entsprechungen des Lernens im Nervensystem der Honigbiene hat sich Joachim ERBER[6] beschäftigt. In einer Einschätzung seiner Ergebnisse stellt er fest daß:
"It is remarkable that the response changes which occur in interneurones during sensitization or conditioning show such a close similarity to the modifications observed in behavioral studies. In this respect, results in bees are similar to those obtained from molluscs and crustaceans."
Ähnlich wie der Plastizitäts-Ansatz geht auch ERBER von einer empirisch vorgefundenen Parallelität von Verhalten und internen Prozessen aus. Zu zeigen bleibt deshalb auch hier wieder, durch welche kausalen oder modalen Transformationen die Phänomene der Verhaltensebene in die, der zellulären übersetzt werden können und vice versa. ERBER hat dazu mit seinen Honigbienen drei Lernexperimente durchgeführt währenddenen er die elektrische Aktivität verschiedener Neurone mittels intrazellulärer Ableitung registrierte:
- Geruchskonditionierung Der Biene werden der Geruch von Zuckerwasser und, an einem Fühler, ein Tropfen Zuckerwasser dargeboten. Fährt sie daraufhin ihren Rüssel aus, wird sie mit einem weiteren Tropfen Zuckerwasser belohnt. Bereits im nächsten Durchgang genügt der Duft damit die Biene ihren Rüssel ausfährt.
- Bewegungskonditionierung Die Stimulation der Fühler mittels Zuckerwasser und ein aufwärts bewegtes schwarz-weißes Streifenmuster werden gleichzeitig dargeboten. Reagiert die Biene mit den Fühlern, wird sie mit Zuckerwasser belohnt. Nach fünf bis zehn Durchgängen reicht das bewegte Muster für diese Reaktion aus.
- Sensibilisierung oder nichtassoziatives Lernen Wird den Fühlern Zuckerwasser dargeboten, dann steigt in der Folge die Warscheinlichkeit, daß Stimulation der Fühler mit Wasserdampf zum Ausfahren des Rüssels führt. Außerdem ist die Reaktion der Fühler auf ein senkrecht bewegtes, schwarz-weißes Streifenmuster in richtungsabhängiger Weise verändert.
Als zentrale Instanz seiner Interpretationen dienen ERBER die multimodalen Neuronen. Grundannahme ist dabei, daß in diesen Neuronen verschiedene Modalitäten 'integriert' werden können, was sich auf der Verhaltensebene als Lernen bezeichnen läßt. Dies gilt sowohl für assoziatives als auch für nichtassoziatives Lernen; die Unterscheidung liegt allein in der zeitlichen Relation der Reize.
Neuronale Entsprechungen konnten für assoziatives wie für nichtassoziatives Lernen gefunden werden:
- Zellen im Protocerebrum, die auf Zuckerwasser-Stimulation des Rüssels reagieren, steigern ihre Geruchs-Empfindlichkeit (Fühler) während des Konditionierens (i). Ein Empfindlichkeitszuwachs für andere Modalitäten lag nicht vor;
- bewegungssensible Neuronen mit Projektionen ins Protocerebrum verändern ihr Antwortverhalten während des Konditionierens mit der Anzahl der Belohnungen (ii). Auch diese sind multimodal und reagieren auf Geruch, mechanische Reizung und Zuckerwasser.
- von mehreren hundert untersuchten bewegungssensiblen Neuronen im Protocerebrum reagierten 75%Prozent auf mehr als eine Modalität. Nach einer Zuckerwasserstimulation zeigten wiederum einige dieser Zellen spezifische Änderungen im Antwortverhalten auf den Bewegungsreiz.
Von ähnlichen Experimenten mit gleicher Zielrichtung berichtete eine Forschergruppe 1982 in der Zeitschrift SCIENCE.[7] Ihr Versuchstier war eine Nacktschnecke mit Namen Aplysia californica.
Der Defensivreflex dieses Tieres ist durch einen gut erforschten neuronalen Schaltkreis vermittelt. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Effekte verschiedener Konditionierungsprozeduren mit diesem Reflex als CR, auf das Verhalten der beteiligten Neuronen zu studieren.
Um die Redundanz innerhalb dieses Kapitels nicht noch mehr zu erhöhen, genügt es, festzuhalten, daß der Erwerb von Verhaltensweisen %a%u%c%h% bei Aplysia californica sehr warscheinlich mit Veränderungen im Antwortverhalten spezieller Synapsen zusammenhängt.
In gewisser Weise ist ein Gedächtnismodell, welches auf diesen Tatsachen basiert, eine Synthese der beiden zuvor dargestellten Ansätze:
Da die Reizübertragung vorwiegend mittels chemischer Synapsen vonstatten geht, besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse aus dem Peptid-Ansatz unter neuen Prämissen zu diskutieren. Andererseits ist hier auch der Plastizitäts-Ansatz hier wiederzufinden: Die graduelle Veränderung des synaptischen Widerstands stellt in dieser Hinsicht eine Verfeinerung des grobschlächtigen 'Alles-oder-Nichts-Prinzips' beim synaptischen Turnover dar.
Gleichzeitig mit der Expandierung des Referenzbereichs dieses Modells auf die Repräsentation von Wissen innerhalb des Organismus verläßt man den Bereich der offen beobachtbaren Mechanismen: Die Konstruktion von Paramorphismen ist indiziert. Zwei der dabei denkbaren und realisierten Vorgehensweisen will ich jetzt referieren.
Eine Forschergruppe, die sich ausschließlich auf chemische Methoden[8] stützt, hat Ende der siebziger Jahre eine Reihe von Arbeiten veröffentlicht, die sich allesamt mit Gedächtnismechanismen befassen.[9] Bemerkenswert erscheint mir dabei die Betrachtung von permanentem Gedächtnis im Rahmen und als Konsequenz eines umfassend angelegten biochemischen Prozesses. Dies ist im Rahmen dieser Arbeit zwar völlig unerheblich, trägt andererseits aber wesentlich zur Plausibilität dieses Ansatzes bei.
Wie die Autoren selbst zugestehen, sind Prozesse von nicht-chemischer Natur mit ihrem Paradigma nicht beobachtbar, was den Geltungsbereich des Ansatzes letzendlich im Unklaren läßt. Über die Prämisse, daß nur die unmittelbar am Beginn anzusiedelnden Prozesse elektrischer Natur sind, können intermittierende nicht-chemische Abläufe vorläufig ausgeschlossen werden.
Das Paradigma setzt sich aus zwei Teilen zusammen:
- besteht in der Konditionierung eines passiven Vermeidungsverhaltens. Einen Tag alte männliche Küken werden trainiert, nach einem 4%mm großen verchromten Kügelchen zu picken. Ist das erreicht, wird das Kügelchen mit einer aversiven Substanz beschichtet. Weigern sich die Küken in der Folge, nach einem gleichen, aber unbeschichteten Kügelchen zu picken, ist das passive Vermeidungsverhalten gelernt.
- Die chemische Manipulation bestand im Verabreichen verschiedener Drogen, die im Verdacht stehen, den Gedächtnisprozess an bestimmten Stellen abzubrechen. Die Verabreichung geschah mittels intracranialer Injektionen von jeweils 10+¦%l pro Hemisphäre. Nach diesen Injektionen wurde dann der Effekt auf das Vermeidungsverhalten geprüft.
Aufgrund ihrer Ergebnisse schlagen GIBBS%&%NG ein sequentielles Drei-Phasen-Modell der Gedächtnisbildung[10] vor. Dessen dritte Phase bestünde in der Bildung permanenter Spuren.
Zur Illustration der Zusammenhänge gebe schematisch das ganze Modell wieder:
Ergebnisse und Folgerungen zu Phase%III des Modells will ich etwas eingehender darstellen:
Die Bildung permanenten Gedächtnisses kann durch die beiden Drogen 'Cycloheximid' (CXM) und 'Anisomycin' behindert werden. Betrachtet man den Verlauf dieses Effektes in Abhängigkeit von dem, zwischen Lernvorgang und Verabreichung verstrichenen, Zeitintervall, dann zeigt sich folgendes:
- die Behaltensleistung innerhalb der ersten 30%Minuten wird kaum berührt. Danach sinkt sie jedoch in auffälliger Weise. Demnach beginnt Phase%III also nach diesem Intervall.
- die maximale Wirksamkeit wird erreicht, wenn die Drogen 5%Minuten vor dem Lernen gegeben werden. Der Verlauf der Behaltensleistung entspricht dann annähernd dem Abklingen von Phase%II.
Berücksichtigt man weiter, daß der Effekt bis zu 72%Stunden nach dem Lernen nicht verschwindet, dann muß angenommen werden, daß es sich dabei eher um eine Behinderung des Lernens als des Erinnerns handelt. Dies führt zu der Frage, welche biochemischen Abläufe eigentlich behindert werden.
Von CXM und Anisomycin ist bekannt, daß sie die Proteinsynthese in den Ribosomen hemmen. Der Effekt von CXM wird durch die Antagonisten Amphetamin, Diphenylhydantoin (DPH) und Noradrenalin (=%Norepinephrin%=%NE) unterlaufen, wenn diese spätestens 30%Minuten nach dem Lernen verabreicht werden. Nach weiteren 180%Minuten (DPH:%60%min) ist dann die Erinnerung fast wieder normal.
DPH unterscheidet sich in einem wichtigen Merkmal von den anderen Antagonisten: Es spielt in der Proteinsynthese des Ribosoms keine Rolle, sein Effekt muß also auf andere Mechanismen zurückführbar sein. Die Hypothese, DPH verlängere die zweite Phase, womit die Zeit bis zum Wiedereinsetzen der Proteinsynthese überbrückt würde, läßt sich durch die Ergebnisse von %G%&%N% bestätigen.
Noch ein weiterer Mechanismus kann durch die Ergebnisse erschlossen werden:
Angenommen, es bestünde eine gegenseitige Abhängigkeit der Na«/K«-Pumpe und des Transports von Aminosäuren durch die Membran. Dann würde DPH nicht nur die zweite Phase verlängern, sondern auch die dritte Phase forcieren, eben weil mehr Aminosäuren transportiert würden. In diesem Fall hätten für die Proteinsynthese nichtmetabolisierbare Aminosäuren denselben Effekt wie CXM, da sie gewissermaßen die Transportwege blockieren würden. Durch DPH müßte dann auch dieser Effekt unterlaufen werden können.
Die Befunde von %G%&%N% lassen auch diese Hypothese als gut bestätigt erscheinen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß:
- die ungestörte Proteinsynthese eine notwendige Bedingung für die Enstehung permanenten Gedächtnisses darstellt;
- diese Proteinsynthese in den Neuronen selbst stattfindet;
- die dazu erforderlichen Aminosäuren während des Speicherprozesses durch die Membran in das Neuron hinein geschafft werden müssen;
- dieser Transport mit der Aktivität der Na«/K«-Pumpe gekoppelt ist.
Unter der Überschrift 'Brain Theorie Meets Experiment in Visual Cortex'[11] haben Leon N. COOPER, Michel IMBERT und Mitarbeiter versucht, die Informationsrepräsentation in neuronalen Netzwerken (hier speziell im visuellen Cortex) mittels formaler Modelle zu studieren. Unter Verwendung des LASHLEY'schen Konzeptes der 'mass action'[12] und der Annahme synaptischer Modifikationen konstruierten sie zunächst ein formal-mathematisches Modell.
Im Zuge der Konstruktion dieses Modells machten sie zwei wesentliche Vereinfachungen, die als Idealisierungen begriffen werden können:
- Vollkommen unmöglich ist es (momentan), sämtliche 10¦¦ Neuronen des menschlichen NS in einem solchen Modell zu berücksichtigen. Stellvertretend benutzen %C%&%I% zwei Sätze logischer Einheiten ('units'). Einer diente als Rezeptoräquivalent, der zweite als erste Instanz interner Repräsentation.
- Trotz dieser ersten Restriktion wäre wiederum die Anzahl der vorbildgemäßen Verbindungen zwischen den beiden Sätzen nicht realisierbar gewesen. Unter der Prämisse, daß sich viele Kanäle schlechter Qualität durch einen mit idealem Übertragungsverhalten ersetzen lassen, ist jedes Unit des 'Rezeptors' nur %e%i%n%m%a%l% mit jedem des zweiten Satzes verbunden.
Mit einem Minimalsystem dieser Form läßt sich bereits ein funktionierendes Gedächtnis simulieren. Das Charakteristische überhaupt an dieser Form von Speicherung ist der Kontrast zu zeitgenössischen Computermetaphern:
Die Information ist nicht an einem (!) einzigen Ort und mit Index oder Adresse versehen, sondern weit verstreut, in jeder Synapse ein kleines Stück, festgehalten %-% von 'außen' betrachtet, ist absolut Nichts zu sehen.[13] Erinnern ist dann auch nicht als Durchprüfen einer Menge adressierter Speicherpositionen zu denken, sondern aufgrund der Organisation dieses 'Assoziativspeichers', als durch den Inhalt adressierter (vermittelter) Zugang zu der jeweiligen Information.[14] Da sich der Speicherprozess in einem solchen Gedächtnis als simultane Änderung des Antwortverhaltens aller Synapsen darstellt, muß sich mindestens eine Funktion formulieren lassen, die diese Änderung beschreibt.
C%&%I% haben verschiedene derartige Funktionen in ihr Modell eingebaut, um das Verhalten seiner übrigen Eigenschaften herauszufinden. Um die Brauchbarkeit des Modells zu demonstrieren, verglichen sie daraufhin dessen Verhalten mit tatsächlich beobachtbaren Phänomenen im visuellen System von Wirbeltieren.
Untersuchungen des visuellen Systems erwachsener Katzen führten zur Entdeckung orientierungssensitiver Neuronen im visuellen Cortex. Diese reagieren in spezifischer Weise auf Muster, wie Linien oder Kreise, mit bestimmter Bewegungsrichtung. Weitere Untersuchungen zeigten, daß sowohl die Anzahl solcher Zellen als auch deren Antwortverhalten veränderbar ist.
Ihre relative Häufigkeit z.B. hängt in ganz auffälliger Weise mit der visuellen Erfahrung während der ersten sieben bis zehn Lebenswochen zusammen. Während dieser Periode scheint ein Reifeprozess abzulaufen, der sich nach IMBERT und Mitarbeitern in drei Stadien manifestiert:
- Unspezifische Zellen haben kreisrunde rezeptive Felder und reagieren auf runde Objekte mit beliebiger Bewegungsrichtung.
- Unreife Zellen haben ebenfalls große, aber rechteckige rezeptive Felder. Sie reagieren auf sich bewegende Objekte derselben Form wenn diese richtig ausgerichtet sind.
- Spezifische Zellen stellen das Endstadium in dieser Entwicklungsfolge dar. Sie haben ebenfalls rechteckige, aber sehr kleine rezeptive Felder.
Vergleiche zweier Gruppen junger Katzen, von denen die einen in völliger Dunkelheit, die anderen unter normalen Verhältnissen gehalten wurden, zeigten, daß:
- unabhängig von der visuellen Erfahrung, bereits zu Beginn der postnatalen Entwicklung eine gewisse Anzahl spezifischer Zellen vorhanden ist.
- im Alter von 17 bis 70 Tagen die weitere Entwicklung solcher Zellen entscheident durch visuelle Erfahrung stimuliert wird.
- im Gegenzug visuelle Deprivation während dieser Periode zu einem Verlust spezifischer Zellen führt.
- im Alter von 42 Tagen bereits eine sechsstündige visuelle Erfahrung genügt, um das Verhältnis der drei Zelltypen zueinander entscheident zu ändern.
Soweit die, für die Arbeit von %C%&%I% relevanten, Befunde aus dem experimentellen Teil ihres Programms.
Der Theorieteil, auf dem das oben skizzierte formale Modell basiert, stützt sich auf die gut erforschte Anatomie des visuellen Systems.
Die beiden Sätze symbolischer Neuronen ('units') entsprechen dem corpus geniculatum lateralis (seitlicher Kniehöcker) einerseits, und dem visuellen Cortex andererseits. Die mittels verschiedener Funktionen beschriebene Dynamik des synaptischen Antwortverhaltens wird als 'passive SchwellenModifikation' (threshold passive modification) bezeichnet. Danach wird eine Zelle ihre Antwort auf wiederholt dargebotene Stimuli derart ändern, daß sie zunehmend (asymptotisch) auf nur ein Muster mit Erregung antwortet.
Mit diesem Modell haben %C%&%I% drei Fälle visueller Erfahrung durchgespielt und den Antwort-Gradienten der symbolischen Neuronen aufgezeichnet:
- Einfache geometrische Muster hatten den durchschlagendsten Effekt. Fast unabhängig von den Parametern des Modells zeigte sich eine Spezialisierung der Zellen. Selbst Rauschabstände, die beträchtlich unterhalb von 0%dB lagen konnten daran kaum etwas ändern.
- Normale visuelle Stimulation führte ebenfalls zu einer Spezialisierung des Antwortverhaltens: Der Gradient entwickelte sich von einer 'Ebene' zu einem 'Nadelfelsen', d.h. es blieb praktisch nur eine Orientierung auf die das 'Neuron' reagierte.
- Rauschen hatte ganz eindeutig den Verlust der Spezialisierung zur Folge. Dies trat ganz unabhängig von der ursprünglichen Orientierung der Zelle ein und zeigte sich in einem 'abbröckeln' des Antwortmaximums zugunsten der Flanken beider Seiten; allerdings lief dieser Prozess langsamer ab als der Anstieg. Wird, nachdem die Spezialisierung weitgehend verschwunden ist, wieder mit Mustern gearbeitet, beginnen die Zellen sich wieder auf bestimmte Orientierungen zu spezialisieren. Es kann sich dabei um eine völlig andere Richtung handeln als zuvor.
Dieser Fall war außerdem am anfälligsten für eine Variation der Systemparameter. So reagierten die Zellen plötzlich auf Parameter der verwendeten Quasizufallsverteilung der Lichtpunkte (Rauschfunktion).
Die Übereinstimmung von Simulation und experimentellen Befunden ist in einer derart gerafften Darstellung von außerordentlicher Prägnanz. Ich denke, sie bedarf keiner weiteren Ausführungen.
| | synapt.Struk. | 1) Präsynapt. | konditionier- | | permanentes | ====> | Strukturänder. | ter Reflex | | (Langzeit-) | Erregbarkeit | | | | Gedächtnis | spez.Neuronen | 2) selbstopti- | Ökologie: | | >>Engramme<< | <===> | mierende Spe- | 'Sukzession' | | | part. Engramm | zialisierung | & 'Klimax' |
Dieser Ansatz enthält bereits soviele selbstständige Bereiche, daß weder die Suche nach Quellen, noch die nach hypothetischen Mechanismen auf Schwierigkeiten stößt.
Seit sich die klassische Konditionierung von einem Modell von Gedächtnis zu einem Modell für Gedächtnis entwickelt hat, liegt der Formulierung existentieller Hypothesen nichts mehr im Wege.
Mehr Probleme schafft da die Annahme einer ökologischen Sukzession als Quelle eines Paramorphismus von Gedächtnis.
Die zuletzt referierten Befunde scheinen dieses Abenteuer wohl zu bestätigen, wobei aber nicht vergessen werden darf, daß auch diese Ergebnisse ganz klar als Anpassungsreaktion auf externe Reizsituationen interpretierbar sind. Es bleibt unklar, wie spezialisierte Neuronen mit Wissensspeicherung in Zusammenhang zu bringen sind.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ vgl. Kap.2: 'Wie?'
- ↑ selbst bei Zugrundelegung des von mir in Kap.1 definierten Gedächtnisbegriffs muß der hier verwendete als stark eingeschränkt bezeichnet werden, da er sich plausibel nur auf Verhaltensmuster anwenden läßt. Für die Repräsentation von Information im ZNS ist er gänzlich unbrauchbar.
- ↑ vgl. Kap.1: 'Leib & Seele'
- ↑ vgl. Libet,B., Kobayashi,H., Tanaka,T. (1975): Synaptic Coupling into the Production and Storage of a Neural Memory Trace.
- ↑ der Ausdruck 'überschaubar' ist tatsächlich relativ zu verstehen. Selbst kleine Nervensysteme können aus bis zu einer Million Neuronen bestehen. Es besteht also kein Anlaß, sich ein kleines NS als besonders primitiv vorzustellen.
- ↑ vgl. Erber,J.: Neural Correlates of Learning in the Honeybee.
- ↑ Carew,T.J., Hawkins,R.D., Kandel,E.R. (1982): Differential Classical Conditioning of a Defensive Withdrawal-Reflex in Aplysia Californica. Hawkins,R.D., Abrams,T.W., Carew,T.J., Kandel,E.R. (1982): A Cellular Mechanism of Classical Conditioning in Aplysia. Walters,E.T. & Byrne,J.H. (1982): Associative Conditioning of Single Sensory Neurons.
- ↑ vgl. 'Paradigmen' in Abschnitt a) dieses Kapitels
- ↑ Gibbs,M.E. & Ng,K.T. (1976): Memory Formation: A New Three-Phase-Model. Gibbs,M.E. & Ng,K.T. (1977): Psychobiology of Memory: Towards a Model of Memory Formation. Gibbs,M.E., Gibbs,C.L., Ng,K.T. (1978): A Possible Physiological Mechanism for Short-Term Memory.
- ↑ Wie bereits weiter oben angedeutet, handelt es sich hier 'nur' um biochemische Prozesse. Der Vorschlag eines sequentiellen Drei-Phasen-Modells wird folgerichtig von den Autoren nur als Minimalannahme formuliert.
- ↑ Cooper,L.N. & Imbert,M.: Seat of Memory. in: THE SCIENCES Februar 1981, S.10-29
- ↑ vgl. Kap.2: 'Wie?'
- ↑ Dies erinnert in eindrucksvoller Weise an PRIBRAMs Hologrammtheorie: Bei normaler Beleuchtung ist auf einem Hologramm kein Bild zu erkennen.
- ↑ Formale Modelle dieser Art jedoch ohne Gegenüberstellung empirischer Befunde haben bereits eine gewisse Tradition: Spinelli,D.N. (1970): Occam: A Computer Model for a Content Addressable Memory in the CNS. Die theoretischen Grundlagen solcher Ansätze kann man bereits seit 1909 in den Monographien von Richard Semon nachlesen. vgl. z.B. Semon,R. (1909): Die mnemischen Empfindungen. Evidenzen für einen Zusammenhang zwischen Semons 'Gesetz der Ekphorie' und den Arbeiten von Spinelli bzw. Cooper & Imbert sind allerdings nicht gegeben.