Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Wie 3: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
;Wie? | ;Wie? | ||
In diesem Abschnitt soll, in der Absicht die Frage nach dem 'Wie' (s.o.: Inhalt (i)) präziser zu formulieren, ein Kategoriensystem gefunden werden, welches erlaubt, die verschiedenen Forschungsansätze zu clustern. Ziel ist, die grundlegenden Ideen zu extrahieren um die Untersuchung der jeweiligen Modelle so effizient wie eben möglich zu gestalten. | In diesem Abschnitt soll, in der Absicht die Frage nach dem 'Wie' (s.o.: Inhalt (i)) präziser zu formulieren, ein Kategoriensystem gefunden werden, welches erlaubt, die verschiedenen Forschungsansätze zu clustern. Ziel ist, die grundlegenden Ideen zu extrahieren um die Untersuchung der jeweiligen Modelle so effizient wie eben möglich zu gestalten.<ref>hier wie auch bei den folgenden Äußerungen gehe ich davon aus, daß in jedem Forschungsansatz ein Modell enthalten ist, selbst dann, wenn explizit keines formuliert wird. Diese Verfahrensweise folgt unmittelbar aus dem in Kapitel 1 (vgl. 'Modell & Theorie') eingeführten Modellbegriff. Da die Modellevaluation logischerweise der Darstellung eines Ansatzes nachgeordnet ist, benutze ich den Terminus 'Idee' als Sammelbezeichnung für die ad hoc vorfindbaren Grundlagen und Prämissen eines Ansatzes.</ref> | ||
Die Konsequenzen der Vorstellung, irgendwelche Vorgänge innerhalb des ZNS seien nicht nur Träger mentaler Phänomene sondern mit diesen äquivalent<ref>vgl. die im Exkurs referierte Position von S.P.R. Rose</ref>, bereiten (auch) dem Nicht-Laien einige Schwierigkeiten. Ein Mangel an Indizien hierfür kann andererseits aber kaum beklagt werden: | |||
Kaum jemand der die Effekte eines mehrfach oxidierten Kohlenwasserstoffs mit der landläufigen Bezeichnung 'Alkohol' noch nicht (mit)erleben durfte. Ganz zu schweigen von den zahlreichen anderen 'Genußmitteln' und Psychopharmaka verschiedenster Wirkung. | Kaum jemand der die Effekte eines mehrfach oxidierten Kohlenwasserstoffs mit der landläufigen Bezeichnung 'Alkohol' noch nicht (mit)erleben durfte. Ganz zu schweigen von den zahlreichen anderen 'Genußmitteln' und Psychopharmaka verschiedenster Wirkung. | ||
C.D. WOODY begnügt sich bereits mit Hinweisen aus einem anderen Gebiet, um seinen Vorschlag einer Arbeitshypothese zu formulieren: | C.D. WOODY begnügt sich bereits mit Hinweisen aus einem anderen Gebiet, um seinen Vorschlag einer Arbeitshypothese zu formulieren: | ||
"The significance of molecular processes as substrates for memory, learning, and higher function needs little justification in light of present knowledge. For those who find such justification necessary, perhaps the most convincing evidence is that of complex innate behavior, behavior that is not acquired through experience, but instead through genetic expression. Such behavior must have a cellular and molecular basis. One can imagine that if innately 'programmed' behavior can have a molecular basis, so too may behavior that is acquired through experience.<ref>Woody,C.D.: Memory, Learning, and Higher Function. (1982)</ref>" Ansätze zur Identifizierung von somatischen und mentalen Prozessen haben eine gewisse Tradition. Aufgrund nichtvorhandener Untersuchungstechniken waren deren Aussagen jedoch anfangs viel zu unspezifisch, um als Basis einer Modellkonstruktion brauchbar zu sein. | "The significance of molecular processes as substrates for memory, learning, and higher function needs little justification in light of present knowledge. For those who find such justification necessary, perhaps the most convincing evidence is that of complex innate behavior, behavior that is not acquired through experience, but instead through genetic expression. Such behavior must have a cellular and molecular basis. One can imagine that if innately 'programmed' behavior can have a molecular basis, so too may behavior that is acquired through experience.<ref>Woody,C.D.: Memory, Learning, and Higher Function. (1982)</ref>" | ||
Ansätze zur Identifizierung von somatischen und mentalen Prozessen haben eine gewisse Tradition. Aufgrund nichtvorhandener Untersuchungstechniken waren deren Aussagen jedoch anfangs viel zu unspezifisch, um als Basis einer Modellkonstruktion brauchbar zu sein. | |||
Von Richard SEMON<ref>vgl. Semon,R.: Bewusstseinsvorgang und Gehirnprozess (1920)</ref> stammen z.B. die Konzepte der 'Ekphorie' und der 'Engraphie', die er im Rahmen einer breit angelegten Theorie des Gedächtnisses formuliert hatte. Dabei identifiziert er einen Gedächtnisinhalt mit dem Gesamtzustand des Organismus zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weil ihm Untersuchungen beispielsweise auf der molekularen Ebene nicht möglich waren, konnte SEMON dieser Annahme keine weiteren Evidenzen hinzufügen, um zu spezielleren Aussagen zu gelangen. | Von Richard SEMON<ref>vgl. Semon,R.: Bewusstseinsvorgang und Gehirnprozess (1920)</ref> stammen z.B. die Konzepte der 'Ekphorie' und der 'Engraphie', die er im Rahmen einer breit angelegten Theorie des Gedächtnisses formuliert hatte. Dabei identifiziert er einen Gedächtnisinhalt mit dem Gesamtzustand des Organismus zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weil ihm Untersuchungen beispielsweise auf der molekularen Ebene nicht möglich waren, konnte SEMON dieser Annahme keine weiteren Evidenzen hinzufügen, um zu spezielleren Aussagen zu gelangen. | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Eric HALGREN und seine Mitarbeiter sind damit bei Menschen auf signifikante Aktivitätsmuster von Neuronen in verschiedenen Diencephalonstrukturen gestoßen, die auftreten, wenn sich Personen mit gedächtnisrelevantem<ref>es bestehen ernstzunehmende Gründe, zu fragen, ob es überhaupt nicht-gedächtnisrelevante Aufgaben gibt. Unter Verwendung der Definition aus Kapitel%2 jedoch ist klar was mit 'gedächtnisrelevant' gemeint ist: Abrufen permanent gespeicherter Information ist notwendig zum Lösen einer Aufgabe.</ref> Aufgabenmaterial beschäftigen.<ref>Halgren,E. Babb,T.L. Crandall,P.H.: Activity of Human Hippocampal Formation and Amygdala Neurons During Memory Testing. in: ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 1978, Vol.45, S.585-601</ref> Seine Ergebnisse lassen sich ohne weiteres als Präzisierung der sechzig Jahre zuvor gemachten Annahmen SEMONs verstehen. | Eric HALGREN und seine Mitarbeiter sind damit bei Menschen auf signifikante Aktivitätsmuster von Neuronen in verschiedenen Diencephalonstrukturen gestoßen, die auftreten, wenn sich Personen mit gedächtnisrelevantem<ref>es bestehen ernstzunehmende Gründe, zu fragen, ob es überhaupt nicht-gedächtnisrelevante Aufgaben gibt. Unter Verwendung der Definition aus Kapitel%2 jedoch ist klar was mit 'gedächtnisrelevant' gemeint ist: Abrufen permanent gespeicherter Information ist notwendig zum Lösen einer Aufgabe.</ref> Aufgabenmaterial beschäftigen.<ref>Halgren,E. Babb,T.L. Crandall,P.H.: Activity of Human Hippocampal Formation and Amygdala Neurons During Memory Testing. in: ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 1978, Vol.45, S.585-601</ref> Seine Ergebnisse lassen sich ohne weiteres als Präzisierung der sechzig Jahre zuvor gemachten Annahmen SEMONs verstehen. | ||
Wie bereits gesagt, läßt sich der Vorgang des 'single-unit-recording' auch umkehren: Es werden keine Ströme abgeleitet, sondern Spannungsimpulse geeigneter Intensität zugeleitet.<ref>Die Zeitschrift HUMAN NEUROBIOLOGY hat ihre erste Ausgabe 1982 vollständig dem Thema 'electrical stimulation techniques' gewidmet. Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei Untersuchungen daraus von besonderem Interesse: Ojemann,G.A.: Models of the Brain Organization for Higher Integrative Functions Derived with Electrical Stimulation Techniques. (S.243-249); Halgren.E.: Mental Phenomena Induced by Stimulation in the Limbic System. (S.251-260)</ref> Diese Arbeit HALGRENs stellt die logische Fortführung seiner oben erwähnten Untersuchung dar: | Wie bereits gesagt, läßt sich der Vorgang des 'single-unit-recording' auch umkehren: Es werden keine Ströme abgeleitet, sondern Spannungsimpulse geeigneter Intensität zugeleitet.<ref>Die Zeitschrift HUMAN NEUROBIOLOGY hat ihre erste Ausgabe 1982 vollständig dem Thema 'electrical stimulation techniques' gewidmet. Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei Untersuchungen daraus von besonderem Interesse: Ojemann,G.A.: Models of the Brain Organization for Higher Integrative Functions Derived with Electrical Stimulation Techniques. (S.243-249); Halgren.E.: Mental Phenomena Induced by Stimulation in the Limbic System. (S.251-260)</ref> | ||
Diese Arbeit HALGRENs stellt die logische Fortführung seiner oben erwähnten Untersuchung dar: | |||
Er hat bei Menschen verschiedene Diencephalonstrukturen stimuliert, und sich dabei deren Erlebnisse berichten lassen. Die Ergebnisse im Einzelnen sind hier weniger von Interesse, als das Problemfeld, an dessen Pforte sie gewissermaßen stehen: | Er hat bei Menschen verschiedene Diencephalonstrukturen stimuliert, und sich dabei deren Erlebnisse berichten lassen. Die Ergebnisse im Einzelnen sind hier weniger von Interesse, als das Problemfeld, an dessen Pforte sie gewissermaßen stehen: | ||
"The mental phenomena evoked by electrical stimulation of the human limbic system confront us directly with the mystery of the physical basis of our subjective experience. What causal chain can we find from an externally imposed gross movement of ions to an intense memory or emotion?"<ref>Halgren,E. (1982) S.251</ref> Ob die Suche tatsächlich kausalen oder eher modalen Transformationen gelten soll will ich in diesem Moment noch nicht untersuchen. Interessant an HALGRENs Untersuchung ist vielmehr der Umstand, daß mit einer (mehr oder minder) simplen Mikroelektrode im ZNS gepeicherte Information auf irgendeine Weise aktiviert (oder 'freigesetzt' oder 'bewußt' oder ...)<ref>Einen entsprechenden Terminus zu finden, bereitet ernste Schwierigkeiten, da gesicherte Erkenntnisse über die Beziehungen von Gedächtnis und subjektivem Erleben kaum existieren.</ref> wird. Eine eingehendere Betrachtung dieses Umstands erfordert eine Diskussion der im vorigen Abschnitt formulierten Frage nach dem Code des ZNS. Da diese mit Sicherheit noch ein gutes Stück von ihrer Beantwortung entfernt ist, will ich sie etwas umformulieren und einschränken: | "The mental phenomena evoked by electrical stimulation of the human limbic system confront us directly with the mystery of the physical basis of our subjective experience. What causal chain can we find from an externally imposed gross movement of ions to an intense memory or emotion?"<ref>Halgren,E. (1982) S.251</ref> | ||
Ob die Suche tatsächlich kausalen oder eher modalen Transformationen gelten soll will ich in diesem Moment noch nicht untersuchen. Interessant an HALGRENs Untersuchung ist vielmehr der Umstand, daß mit einer (mehr oder minder) simplen Mikroelektrode im ZNS gepeicherte Information auf irgendeine Weise aktiviert (oder 'freigesetzt' oder 'bewußt' oder ...)<ref>Einen entsprechenden Terminus zu finden, bereitet ernste Schwierigkeiten, da gesicherte Erkenntnisse über die Beziehungen von Gedächtnis und subjektivem Erleben kaum existieren.</ref> wird. | |||
Eine eingehendere Betrachtung dieses Umstands erfordert eine Diskussion der im vorigen Abschnitt formulierten Frage nach dem Code des ZNS. Da diese mit Sicherheit noch ein gutes Stück von ihrer Beantwortung entfernt ist, will ich sie etwas umformulieren und einschränken: | |||
Analog dem Vokabular einer Schriftsprache (Paramorphismus!) bedarf auch das Vokabular des Informationsflusses innerhalb des ZNS eines Mediums -> keine Software ohne Hardware nämlich! Solange die Natur dieses Mediums unklar ist, können keine Aussagen über das Vokabular selbst gemacht werden. Erst nach Klärung dieses Punktes können in der immensen Flut zentralnervöser Vorgänge eventuell die Muster erkannt werden, die von semantischer Relevanz sind. Die Frage nach dem Code des ZNS muß deshalb zuerst als Frage nach dem (den) Träger(n) bzw. nach dem (den) Trägerprozess(en) gestellt werden. | Analog dem Vokabular einer Schriftsprache (Paramorphismus!) bedarf auch das Vokabular des Informationsflusses innerhalb des ZNS eines Mediums -> keine Software ohne Hardware nämlich! Solange die Natur dieses Mediums unklar ist, können keine Aussagen über das Vokabular selbst gemacht werden. Erst nach Klärung dieses Punktes können in der immensen Flut zentralnervöser Vorgänge eventuell die Muster erkannt werden, die von semantischer Relevanz sind. Die Frage nach dem Code des ZNS muß deshalb zuerst als Frage nach dem (den) Träger(n) bzw. nach dem (den) Trägerprozess(en) gestellt werden. | ||
| Zeile 34: | Zeile 42: | ||
"Da es sich [beim äußeren Verhalten] normalerweise um sinnvolle und koordinierte Bewegungsfolgen handelt, müssen die ihnen zugrundeliegenden Muskelbewegungen als dauernde Informationsabgabe betrachtet werden." (S.199) | "Da es sich [beim äußeren Verhalten] normalerweise um sinnvolle und koordinierte Bewegungsfolgen handelt, müssen die ihnen zugrundeliegenden Muskelbewegungen als dauernde Informationsabgabe betrachtet werden." (S.199) | ||
"Die ganze Zelle weist einen so hohen Ordnungsgrad auf, daß keine Reaktion (im Stoffwechsel) ablaufen kann, ohne durch eine Informationsübertragung verursacht zu sein | "Die ganze Zelle weist einen so hohen Ordnungsgrad auf, daß keine Reaktion (im Stoffwechsel) ablaufen kann, ohne durch eine Informationsübertragung verursacht zu sein."<ref>Diese Annahme führt in SCHALTEGGERs weiteren Überlegungen zu einer Art 'Informations-Erhaltungssatz'. Da er zufällige Vorgänge ausschließt, führt er das Gedächtnis als Puffer zwischen Aufnahme und Abgabe ein.</ref> (S.241) | ||
Damit hat SCHALTEGGER in trivialster Weise das Feld abgesteckt in dem nach den Trägern der Information gesucht werden muß: Prinzipiell ist alles, was innerhalb des Organismus abläuft, als codierte Information zu sehen. Zu leisten bleibt eine Kategorisierung der verschiedenen Prozesse, die SCHALTEGGER zur Unterscheidung dreier Codes veranlaßt: | |||
/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\ | |||
| Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt | | |||
| | | |||
| //========================================\\ | | |||
| Umwelt || O R G A N I S M U S O R G A N I S M U S || Umwelt | | |||
| || || | | |||
| || +> elektrisch || | | |||
| || : V || | | |||
| Umwelt ----+-> REZEPTOR -+ chemisch + MUSKEL -+---> Umwelt | | |||
| || : V : : || | | |||
| || : mechanisch -+ V || | | |||
| Umwelt || : : || Umwelt | | |||
| || +--------- interne Rückkopplung <------+ || | | |||
| || || | | |||
| Umwelt || O R G A N I S M U S O R G A N I S M U S || Umwelt | | |||
| \\========================================// | | |||
| | | |||
| Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt | | |||
\______________________________________________________________/ | |||
Wie sich leicht erkennen läßt, gruppiert SCHALTEGGER die potentiellen Medien nach physikalischen Gesichtspunkten: Es gibt (einen) mechanische(n), elektrische(n) und chemische(n) Code(s). Diese Einteilung ist ad hoc nicht disjunkt, da der elektrische Code spätestens an der Synapse chemisch vermittelt ist. Was SCHALTEGGER unter chemischem Code versteht, ist allerdings von den synaptischen Transmittersubstanzen zu unterscheiden: Nach seiner Vorstellung sind darunter ein sogenannter 'Peptid-Code' zu verstehen. | Wie sich leicht erkennen läßt, gruppiert SCHALTEGGER die potentiellen Medien nach physikalischen Gesichtspunkten: Es gibt (einen) mechanische(n), elektrische(n) und chemische(n) Code(s). Diese Einteilung ist ad hoc nicht disjunkt, da der elektrische Code spätestens an der Synapse chemisch vermittelt ist. Was SCHALTEGGER unter chemischem Code versteht, ist allerdings von den synaptischen Transmittersubstanzen zu unterscheiden: Nach seiner Vorstellung sind darunter ein sogenannter 'Peptid-Code' zu verstehen. | ||
SCHALTEGGERs Kategorien sind für meine Zwecke auch noch nicht ganz vollständig: Alle von ihm angenommenen Codes legen eine invariante Organisation des ZNS zugrunde, das als eine Art hochkomplexer Computer angesehen wird. Meiner Ansicht nach darf aber die organisatorische nicht über der strukturellen<ref>vgl. Kap.1: 'Struktur & Organisation'</ref> Variabilität des ZNS vergessen werden. Diese Idee ist keineswegs neu: Heinz von FOERSTER hat sie bereits auf dem 'ersten Symposium über Lernen, Erinnern und Vergessen' im Jahre 1963 vorgestellt und auf ihre Vorteile gegenüber anderen Konzepten hingewiesen.<ref>Foerster,H.von: Memory Without Record. in: KIMBLE,D.P.: The Anatomy of Memory. (1965)</ref> Der Organismus bzw. das ZNS stellt so betrachtet selbst die gespeicherte Information dar, ist also mehr als ein 'simpler' Informationsspeicher.<ref>Führt man diesen Ansatz konsequent weiter, d.h. über das Feld der Gedächtnisforschung hinaus, so ergeben sich eine Reihe hochinteressanter Folgerungen. Da das den Rahmen dieses Kapitels mit Sicherheit sprengen würde, will ich dem ein eigenes Kapitel am Schluß dieser Arbeit widmen.</ref> Berücksichtigt man daß SCHALTEGGERs Theorie die Informationsverarbeitung zum Gegenstand hat, dann ist bei der von mir eingeführten Verwendung des Terminus 'Gedächtnis' nur der chemische 'Code' als Speichermodus verwendbar.<ref>vgl. Kap.1: 'Wahrnehmung & Gedächtnis' Informationsverarbeitung bezieht sich eben auch auf den dynamischen Aspekt des ZNS. Diesen Bereich habe ich aber aus meinem Gedächtnisbegriff herausgenommen, so daß ich höchstens tonische Veränderungen als gespeicherte Information zulassen kann; also keine elektrischen Impulsfolgen und keine mechanisch zu beschreibenden Aktivitätsmuster des Muskelapparates.</ref> Zusammen mit dem Konzept FOERSTERs verbleiben dann noch zwei Kategorien von Formen der Speicherung. | SCHALTEGGERs Kategorien sind für meine Zwecke auch noch nicht ganz vollständig: Alle von ihm angenommenen Codes legen eine invariante Organisation des ZNS zugrunde, das als eine Art hochkomplexer Computer angesehen wird. Meiner Ansicht nach darf aber die organisatorische nicht über der strukturellen<ref>vgl. Kap.1: 'Struktur & Organisation'</ref> Variabilität des ZNS vergessen werden. Diese Idee ist keineswegs neu: Heinz von FOERSTER hat sie bereits auf dem 'ersten Symposium über Lernen, Erinnern und Vergessen' im Jahre 1963 vorgestellt und auf ihre Vorteile gegenüber anderen Konzepten hingewiesen.<ref>Foerster,H.von: Memory Without Record. in: KIMBLE,D.P.: The Anatomy of Memory. (1965)</ref> Der Organismus bzw. das ZNS stellt so betrachtet selbst die gespeicherte Information dar, ist also mehr als ein 'simpler' Informationsspeicher.<ref>Führt man diesen Ansatz konsequent weiter, d.h. über das Feld der Gedächtnisforschung hinaus, so ergeben sich eine Reihe hochinteressanter Folgerungen. Da das den Rahmen dieses Kapitels mit Sicherheit sprengen würde, will ich dem ein eigenes Kapitel am Schluß dieser Arbeit widmen.</ref> | ||
Berücksichtigt man daß SCHALTEGGERs Theorie die Informationsverarbeitung zum Gegenstand hat, dann ist bei der von mir eingeführten Verwendung des Terminus 'Gedächtnis' nur der chemische 'Code' als Speichermodus verwendbar.<ref>vgl. Kap.1: 'Wahrnehmung & Gedächtnis' Informationsverarbeitung bezieht sich eben auch auf den dynamischen Aspekt des ZNS. Diesen Bereich habe ich aber aus meinem Gedächtnisbegriff herausgenommen, so daß ich höchstens tonische Veränderungen als gespeicherte Information zulassen kann; also keine elektrischen Impulsfolgen und keine mechanisch zu beschreibenden Aktivitätsmuster des Muskelapparates.</ref> Zusammen mit dem Konzept FOERSTERs verbleiben dann noch zwei Kategorien von Formen der Speicherung. | |||
Um das Argument dieses Abschnitts herauszustellen, will ich es entlang eines 'roten Fadens' wiederholen: | Um das Argument dieses Abschnitts herauszustellen, will ich es entlang eines 'roten Fadens' wiederholen: | ||
| Zeile 69: | Zeile 101: | ||
Ausgehend von dieser Systematisierung muß die Beantwortung der Frage nach der Art der permanenten Veränderungen im Zusammenhang mit Gedächtnis also mindestens zwei Teilbereiche berücksichtigen. Da die Trennungslinie zwischen diesen beiden Bereichen nicht scharf gezogen werden kann, kommt noch ein Bereich hinzu. Je nach persönlichem Standpunkt kann man diesen als Synthese, Interaktion oder Elaboration der beiden 'reinen' Formen bezeichnen. | Ausgehend von dieser Systematisierung muß die Beantwortung der Frage nach der Art der permanenten Veränderungen im Zusammenhang mit Gedächtnis also mindestens zwei Teilbereiche berücksichtigen. Da die Trennungslinie zwischen diesen beiden Bereichen nicht scharf gezogen werden kann, kommt noch ein Bereich hinzu. Je nach persönlichem Standpunkt kann man diesen als Synthese, Interaktion oder Elaboration der beiden 'reinen' Formen bezeichnen. | ||
#Peptide | #Peptide: Wenn das ZNS lediglich als Instanz der Informationsverarbeitung betrachtet wird, dann muß (müssen) der (die) Speicher irgendwo anders zu finden sein. Dieser Ansatz nimmt an, daß Ketten von Aminosäuren (Peptide), die im CSF (= Cerebro-Spinal-Fluid) enthalten sind, das Gedächtnis darstellen. | ||
Wenn das ZNS lediglich als Instanz der Informationsverarbeitung betrachtet wird, dann muß (müssen) der (die) Speicher irgendwo anders zu finden sein. Dieser Ansatz nimmt an, daß Ketten von Aminosäuren (Peptide), die im CSF (= Cerebro-Spinal-Fluid) enthalten sind, das Gedächtnis darstellen. | |||
#Plastizität: Nimmt man keine Veränderungen auf molekularem Niveau an, so ist die Variation im zellulären Bereich zu suchen. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Position der Synapsen einer Dynamik unterliegt, die mit dem Gedächtnis in Beziehung steht. | #Plastizität: Nimmt man keine Veränderungen auf molekularem Niveau an, so ist die Variation im zellulären Bereich zu suchen. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Position der Synapsen einer Dynamik unterliegt, die mit dem Gedächtnis in Beziehung steht. | ||
#synaptischer Widerstand: Eine Vorstellung, die bereits bei den atomistischen Assoziationisten<ref>vgl. Kap.2: 'Wie?'</ref> zu finden war, nimmt an, daß Synapsen ihre Reaktion als Funktion ihrer relativen Aktivierung ändern. Der dabei verwendete Term 'Spur' entstammt der Idee, daß ein häufig benutzter Weg zunehmend leichter passierbar wird. | #synaptischer Widerstand: Eine Vorstellung, die bereits bei den atomistischen Assoziationisten<ref>vgl. Kap.2: 'Wie?'</ref> zu finden war, nimmt an, daß Synapsen ihre Reaktion als Funktion ihrer relativen Aktivierung ändern. Der dabei verwendete Term 'Spur' entstammt der Idee, daß ein häufig benutzter Weg zunehmend leichter passierbar wird. | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2025, 14:19 Uhr
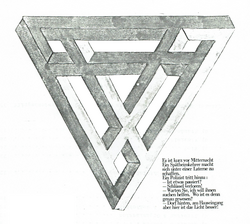
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Wie?
In diesem Abschnitt soll, in der Absicht die Frage nach dem 'Wie' (s.o.: Inhalt (i)) präziser zu formulieren, ein Kategoriensystem gefunden werden, welches erlaubt, die verschiedenen Forschungsansätze zu clustern. Ziel ist, die grundlegenden Ideen zu extrahieren um die Untersuchung der jeweiligen Modelle so effizient wie eben möglich zu gestalten.[1]
Die Konsequenzen der Vorstellung, irgendwelche Vorgänge innerhalb des ZNS seien nicht nur Träger mentaler Phänomene sondern mit diesen äquivalent[2], bereiten (auch) dem Nicht-Laien einige Schwierigkeiten. Ein Mangel an Indizien hierfür kann andererseits aber kaum beklagt werden:
Kaum jemand der die Effekte eines mehrfach oxidierten Kohlenwasserstoffs mit der landläufigen Bezeichnung 'Alkohol' noch nicht (mit)erleben durfte. Ganz zu schweigen von den zahlreichen anderen 'Genußmitteln' und Psychopharmaka verschiedenster Wirkung.
C.D. WOODY begnügt sich bereits mit Hinweisen aus einem anderen Gebiet, um seinen Vorschlag einer Arbeitshypothese zu formulieren:
"The significance of molecular processes as substrates for memory, learning, and higher function needs little justification in light of present knowledge. For those who find such justification necessary, perhaps the most convincing evidence is that of complex innate behavior, behavior that is not acquired through experience, but instead through genetic expression. Such behavior must have a cellular and molecular basis. One can imagine that if innately 'programmed' behavior can have a molecular basis, so too may behavior that is acquired through experience.[3]"
Ansätze zur Identifizierung von somatischen und mentalen Prozessen haben eine gewisse Tradition. Aufgrund nichtvorhandener Untersuchungstechniken waren deren Aussagen jedoch anfangs viel zu unspezifisch, um als Basis einer Modellkonstruktion brauchbar zu sein.
Von Richard SEMON[4] stammen z.B. die Konzepte der 'Ekphorie' und der 'Engraphie', die er im Rahmen einer breit angelegten Theorie des Gedächtnisses formuliert hatte. Dabei identifiziert er einen Gedächtnisinhalt mit dem Gesamtzustand des Organismus zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weil ihm Untersuchungen beispielsweise auf der molekularen Ebene nicht möglich waren, konnte SEMON dieser Annahme keine weiteren Evidenzen hinzufügen, um zu spezielleren Aussagen zu gelangen.
Inzwischen sind nun eine ganze Reihe von Forschungsmethoden entwickelt worden, die Aussagen über Vorgänge auf zellulärem und molekularem Niveau ermöglichen (s.o.). Die Methode der sogenannten 'single-unit-recordings' hat dabei eine besondere Bedeutung erlangt.
Eric HALGREN und seine Mitarbeiter sind damit bei Menschen auf signifikante Aktivitätsmuster von Neuronen in verschiedenen Diencephalonstrukturen gestoßen, die auftreten, wenn sich Personen mit gedächtnisrelevantem[5] Aufgabenmaterial beschäftigen.[6] Seine Ergebnisse lassen sich ohne weiteres als Präzisierung der sechzig Jahre zuvor gemachten Annahmen SEMONs verstehen.
Wie bereits gesagt, läßt sich der Vorgang des 'single-unit-recording' auch umkehren: Es werden keine Ströme abgeleitet, sondern Spannungsimpulse geeigneter Intensität zugeleitet.[7]
Diese Arbeit HALGRENs stellt die logische Fortführung seiner oben erwähnten Untersuchung dar:
Er hat bei Menschen verschiedene Diencephalonstrukturen stimuliert, und sich dabei deren Erlebnisse berichten lassen. Die Ergebnisse im Einzelnen sind hier weniger von Interesse, als das Problemfeld, an dessen Pforte sie gewissermaßen stehen:
"The mental phenomena evoked by electrical stimulation of the human limbic system confront us directly with the mystery of the physical basis of our subjective experience. What causal chain can we find from an externally imposed gross movement of ions to an intense memory or emotion?"[8]
Ob die Suche tatsächlich kausalen oder eher modalen Transformationen gelten soll will ich in diesem Moment noch nicht untersuchen. Interessant an HALGRENs Untersuchung ist vielmehr der Umstand, daß mit einer (mehr oder minder) simplen Mikroelektrode im ZNS gepeicherte Information auf irgendeine Weise aktiviert (oder 'freigesetzt' oder 'bewußt' oder ...)[9] wird.
Eine eingehendere Betrachtung dieses Umstands erfordert eine Diskussion der im vorigen Abschnitt formulierten Frage nach dem Code des ZNS. Da diese mit Sicherheit noch ein gutes Stück von ihrer Beantwortung entfernt ist, will ich sie etwas umformulieren und einschränken:
Analog dem Vokabular einer Schriftsprache (Paramorphismus!) bedarf auch das Vokabular des Informationsflusses innerhalb des ZNS eines Mediums -> keine Software ohne Hardware nämlich! Solange die Natur dieses Mediums unklar ist, können keine Aussagen über das Vokabular selbst gemacht werden. Erst nach Klärung dieses Punktes können in der immensen Flut zentralnervöser Vorgänge eventuell die Muster erkannt werden, die von semantischer Relevanz sind. Die Frage nach dem Code des ZNS muß deshalb zuerst als Frage nach dem (den) Träger(n) bzw. nach dem (den) Trägerprozess(en) gestellt werden.
Einen Anlauf, die verschiedenen denkbaren Medien innerhalb des ZNS in einer Theorie der "Informationsübertragung im tierischen Organismus" zu integrieren hat H. SCHALTEGGER[10] 1966 unternommen. Auch er macht keine Aussagen über den Code des ZNS, was genau dann klar wird wenn man die Schnittstellen zwischen den von ihm postulierten 'Codes'[11] betrachtet. Für eine Systematisierung der Trägerprozesse und -substanzen allerdings besitzt sein Ansatz einen gewissen[12] heuristischen Wert. Dies will ich im Folgenden etwas näher erläutern.
Bemerkenswert ist gleich SCHALTEGGERs erste These, in der er einen absoluten Determinismus vertritt. Allerdings einen von solcher Komplexität, daß dieser weder falsifizierbar noch verifizierbar ist - ein Axiom also:
"Der Schwerpunkt der vorliegenden Betrachtung liegt nicht bei den sogenannten Stoffwechselvorgängen. Das ordnende Prinzip im lebenden Organismus ist Information (= organisierte Materie und 'organisierte Energieübertragung')." (S.198)
"Da es sich [beim äußeren Verhalten] normalerweise um sinnvolle und koordinierte Bewegungsfolgen handelt, müssen die ihnen zugrundeliegenden Muskelbewegungen als dauernde Informationsabgabe betrachtet werden." (S.199)
"Die ganze Zelle weist einen so hohen Ordnungsgrad auf, daß keine Reaktion (im Stoffwechsel) ablaufen kann, ohne durch eine Informationsübertragung verursacht zu sein."[13] (S.241)
Damit hat SCHALTEGGER in trivialster Weise das Feld abgesteckt in dem nach den Trägern der Information gesucht werden muß: Prinzipiell ist alles, was innerhalb des Organismus abläuft, als codierte Information zu sehen. Zu leisten bleibt eine Kategorisierung der verschiedenen Prozesse, die SCHALTEGGER zur Unterscheidung dreier Codes veranlaßt:
/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\ | Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt | | | | //========================================\\ | | Umwelt || O R G A N I S M U S O R G A N I S M U S || Umwelt | | || || | | || +> elektrisch || | | || : V || | | Umwelt ----+-> REZEPTOR -+ chemisch + MUSKEL -+---> Umwelt | | || : V : : || | | || : mechanisch -+ V || | | Umwelt || : : || Umwelt | | || +--------- interne Rückkopplung <------+ || | | || || | | Umwelt || O R G A N I S M U S O R G A N I S M U S || Umwelt | | \\========================================// | | | | Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt Umwelt | \______________________________________________________________/
Wie sich leicht erkennen läßt, gruppiert SCHALTEGGER die potentiellen Medien nach physikalischen Gesichtspunkten: Es gibt (einen) mechanische(n), elektrische(n) und chemische(n) Code(s). Diese Einteilung ist ad hoc nicht disjunkt, da der elektrische Code spätestens an der Synapse chemisch vermittelt ist. Was SCHALTEGGER unter chemischem Code versteht, ist allerdings von den synaptischen Transmittersubstanzen zu unterscheiden: Nach seiner Vorstellung sind darunter ein sogenannter 'Peptid-Code' zu verstehen.
SCHALTEGGERs Kategorien sind für meine Zwecke auch noch nicht ganz vollständig: Alle von ihm angenommenen Codes legen eine invariante Organisation des ZNS zugrunde, das als eine Art hochkomplexer Computer angesehen wird. Meiner Ansicht nach darf aber die organisatorische nicht über der strukturellen[14] Variabilität des ZNS vergessen werden. Diese Idee ist keineswegs neu: Heinz von FOERSTER hat sie bereits auf dem 'ersten Symposium über Lernen, Erinnern und Vergessen' im Jahre 1963 vorgestellt und auf ihre Vorteile gegenüber anderen Konzepten hingewiesen.[15] Der Organismus bzw. das ZNS stellt so betrachtet selbst die gespeicherte Information dar, ist also mehr als ein 'simpler' Informationsspeicher.[16]
Berücksichtigt man daß SCHALTEGGERs Theorie die Informationsverarbeitung zum Gegenstand hat, dann ist bei der von mir eingeführten Verwendung des Terminus 'Gedächtnis' nur der chemische 'Code' als Speichermodus verwendbar.[17] Zusammen mit dem Konzept FOERSTERs verbleiben dann noch zwei Kategorien von Formen der Speicherung.
Um das Argument dieses Abschnitts herauszustellen, will ich es entlang eines 'roten Fadens' wiederholen:
START | (1) Äquivalenz von Mentalem und Physischem | (2) Genussmittel, angeborenes Verhalten, C.WOODY | (3) globale Aussagen, R.SEMON | (4) neue Methoden | (5) spezifischere Aussagen, E.HALGREN | (6) Ableitung | (7) Stimulation | (8) was wird bewirkt? | (9) Code | (10) Medium?, H.SCHALTEGGER, H.FOERSTER | (11) Systematisierung | ENDE!
Ausgehend von dieser Systematisierung muß die Beantwortung der Frage nach der Art der permanenten Veränderungen im Zusammenhang mit Gedächtnis also mindestens zwei Teilbereiche berücksichtigen. Da die Trennungslinie zwischen diesen beiden Bereichen nicht scharf gezogen werden kann, kommt noch ein Bereich hinzu. Je nach persönlichem Standpunkt kann man diesen als Synthese, Interaktion oder Elaboration der beiden 'reinen' Formen bezeichnen.
- Peptide: Wenn das ZNS lediglich als Instanz der Informationsverarbeitung betrachtet wird, dann muß (müssen) der (die) Speicher irgendwo anders zu finden sein. Dieser Ansatz nimmt an, daß Ketten von Aminosäuren (Peptide), die im CSF (= Cerebro-Spinal-Fluid) enthalten sind, das Gedächtnis darstellen.
- Plastizität: Nimmt man keine Veränderungen auf molekularem Niveau an, so ist die Variation im zellulären Bereich zu suchen. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Position der Synapsen einer Dynamik unterliegt, die mit dem Gedächtnis in Beziehung steht.
- synaptischer Widerstand: Eine Vorstellung, die bereits bei den atomistischen Assoziationisten[18] zu finden war, nimmt an, daß Synapsen ihre Reaktion als Funktion ihrer relativen Aktivierung ändern. Der dabei verwendete Term 'Spur' entstammt der Idee, daß ein häufig benutzter Weg zunehmend leichter passierbar wird.
Diese Ansätze will ich in den folgenden drei Abschnitten (b1,b2,b3) ausführlich darstellen um den (meist implizit) zugrundegelegten Modellen auf die Spur zu kommen.[19]
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ hier wie auch bei den folgenden Äußerungen gehe ich davon aus, daß in jedem Forschungsansatz ein Modell enthalten ist, selbst dann, wenn explizit keines formuliert wird. Diese Verfahrensweise folgt unmittelbar aus dem in Kapitel 1 (vgl. 'Modell & Theorie') eingeführten Modellbegriff. Da die Modellevaluation logischerweise der Darstellung eines Ansatzes nachgeordnet ist, benutze ich den Terminus 'Idee' als Sammelbezeichnung für die ad hoc vorfindbaren Grundlagen und Prämissen eines Ansatzes.
- ↑ vgl. die im Exkurs referierte Position von S.P.R. Rose
- ↑ Woody,C.D.: Memory, Learning, and Higher Function. (1982)
- ↑ vgl. Semon,R.: Bewusstseinsvorgang und Gehirnprozess (1920)
- ↑ es bestehen ernstzunehmende Gründe, zu fragen, ob es überhaupt nicht-gedächtnisrelevante Aufgaben gibt. Unter Verwendung der Definition aus Kapitel%2 jedoch ist klar was mit 'gedächtnisrelevant' gemeint ist: Abrufen permanent gespeicherter Information ist notwendig zum Lösen einer Aufgabe.
- ↑ Halgren,E. Babb,T.L. Crandall,P.H.: Activity of Human Hippocampal Formation and Amygdala Neurons During Memory Testing. in: ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 1978, Vol.45, S.585-601
- ↑ Die Zeitschrift HUMAN NEUROBIOLOGY hat ihre erste Ausgabe 1982 vollständig dem Thema 'electrical stimulation techniques' gewidmet. Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei Untersuchungen daraus von besonderem Interesse: Ojemann,G.A.: Models of the Brain Organization for Higher Integrative Functions Derived with Electrical Stimulation Techniques. (S.243-249); Halgren.E.: Mental Phenomena Induced by Stimulation in the Limbic System. (S.251-260)
- ↑ Halgren,E. (1982) S.251
- ↑ Einen entsprechenden Terminus zu finden, bereitet ernste Schwierigkeiten, da gesicherte Erkenntnisse über die Beziehungen von Gedächtnis und subjektivem Erleben kaum existieren.
- ↑ Schaltegger,H.: Versuch einer allgemeinen Theorie der chemisch-elektrischen Informationsübertragung im tierischen Organismus (I-III). in: CHIMIA 20, 1966, S.197ff (I), S.237ff (II), S.389ff (III)
- ↑ Schalteggers Code ist tatsächlich etwas völlig anderes: Sein Terminus kennzeichnet lediglich das Medium, in dem Information codiert ist. Dies muß zu letztendlich zu Aussagen führen, die bei Beachtung der tatsächlichen Bedeutung höchstens als interessante Spekulation betrachtet werden können. Wäre Code im korrekten Sinn verwendet, müßte eine Vorschrift angebbar sein, mittels der die Information decodiert werden könnte. Dies ist hier nicht der Fall!
- ↑ An dieser Stelle ist Vorsicht geboten: Die Annahme, Informationsverarbeitung und -speicherung bedienten sich desselben Codes oder gar derselben Medien, kann vorerst %n%u%r% als Heuristik angesehen werden.
- ↑ Diese Annahme führt in SCHALTEGGERs weiteren Überlegungen zu einer Art 'Informations-Erhaltungssatz'. Da er zufällige Vorgänge ausschließt, führt er das Gedächtnis als Puffer zwischen Aufnahme und Abgabe ein.
- ↑ vgl. Kap.1: 'Struktur & Organisation'
- ↑ Foerster,H.von: Memory Without Record. in: KIMBLE,D.P.: The Anatomy of Memory. (1965)
- ↑ Führt man diesen Ansatz konsequent weiter, d.h. über das Feld der Gedächtnisforschung hinaus, so ergeben sich eine Reihe hochinteressanter Folgerungen. Da das den Rahmen dieses Kapitels mit Sicherheit sprengen würde, will ich dem ein eigenes Kapitel am Schluß dieser Arbeit widmen.
- ↑ vgl. Kap.1: 'Wahrnehmung & Gedächtnis' Informationsverarbeitung bezieht sich eben auch auf den dynamischen Aspekt des ZNS. Diesen Bereich habe ich aber aus meinem Gedächtnisbegriff herausgenommen, so daß ich höchstens tonische Veränderungen als gespeicherte Information zulassen kann; also keine elektrischen Impulsfolgen und keine mechanisch zu beschreibenden Aktivitätsmuster des Muskelapparates.
- ↑ vgl. Kap.2: 'Wie?'
- ↑ ich möchte hier bereits auf eine weitere Dichotomisierung des Gedächtnisbegriffs aus Kap.1 hinweisen: Die Trennung in 'gelerntes Verhalten' und 'erworbenes Wissen'. Wie in Abschnitt f) dieses Kapitels noch diskutiert werden wird, sind diese beiden Engramm-Spezies bezüglich ihrer Substrate verschieden. Eine wechselseitige Verallgemeinerung zugehöriger experimenteller Befunde ist daher nur unter starken Vorbehalten genießbar. vgl. dazu: Flechtner,H.-J. (1976): Biologie des Lernens %-% Memoria und Mneme Bd.2