Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Pyramiden: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984}} <font size="3" face="Gothic"> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} </font> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}}“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | ||
;Pyramiden | |||
"A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that works." | |||
Mit diesem Absatz aus MURPHYs Technologie-Gesetzen sind die Besonderheiten der Gedächtnistheorie von Marvin MINSKY gegenüber den bisher in diesem Kapitel referierten Ansätzen gut charakterisiert. MINSKY weist ganz entschieden auf die ontogenetischen Aspekte von Gedächtnisprozessen hin: | |||
"I doubt that human memory has the same uniform, invariant character throughout development, and do not want to attribute to infants capacities that develop only later. (118) | |||
... one must not assume that "concrete" recollections are basically the simplest; that is an illusion reflecting the enormous competence of the adult mental systems ... (119) | |||
... attitudes do really precede propositions, feelings come before facts. This seems strange only because we cannot remember what we knew in infancy. (120)"<ref>Minsky,M. (1980): K-Lines: A theory of memory.</ref> | |||
Über die nicht gänzlich unplausible Prämisse einer qualitativen Ontogenese von Informationsrepräsentationen erreicht MINSKY eine Verschiebung der Prioritäten von Propositionen zu Dispositionen. Damit steht er keineswegs alleine; Patrick RABBITT beispielsweise muß etwas Ähnliches gemeint haben, wenn er über Gedächtnismodelle schreibt: | |||
"... next there was the "filter" which bogged down whole generations of research workers who took it for a coffee strainer rather than for the tuned resonator ist plainly is."<ref>Rabbitt,P. (1984): Simplistic heuristics and Maltese acrostics. S.78</ref> Wie dieser Resonator 'getuned' wird, d.h. wie eine Disposition in diesem Sinne zustandekommt, klingt recht einfach: | |||
Wenn man ein Problem löst, eine Idee oder ein (be)merkenswertes Erlebnis hat, wird eine sogenannte 'K-Line' erzeugt. Diese K-Line verbindet alle 'mentalen Einheiten' die inzwischen aktiv waren. Wird sie später reaktiviert, so erzeugt sie einen 'partiellen mentalen Zustand', indem sie einige dieser mentalen Einheiten reaktiviert und das Ereignis so teilweise reproduziert. | |||
Die Terminologie dieser Darstellung erfordert, daß MINSKY sich in irgendeiner Weise auf das neurologische Substrat von Gedächtnis bezieht. Tatsächlich versucht er, eine Systematisierung der Anatomie zu leisten, die eine Speicherung mittels struktureller Variationen erlaubt. Die wichtigste dieser Variationen ist die Erzeugung von K-Lines. Um diese Systematisierung genügend durchschaubar zu machen, bedarf es zunächst einer Klärung der oben eingeführten Begriffe. Minsky erledigt all das in einem Akt. | |||
*Das ZNS ist für ihn eine Gesellschaft vieler kleiner, relativ autonomer Einheiten die er als 'Agents' bezeichnet. Die Organisation dieser Gesellschaft wird in drei Punkten definiert: | |||
#Eine erste grobe Einteilung richtet sich nach Funktionen wie Reizverarbeitung, Sprache, Planung, usw. | |||
#Diese Bereiche bestehen aus einzelnen Agents (s.o.), von von denen jedes mit einer Zustandsänderung auf bestimmte Reizmuster reagiert. Diese erfüllen somit die Funktion von Feature-Detektoren. | |||
#Die möglichen Zustände sind im Minimalfall nur zwei: aktiv oder inaktiv. Ein mentaler Zustand wird so definiert als Muster aller zu einem Zeitpunkt aktiven Agents; ein partieller mentaler Zustand bezeichnet analog dazu ein Muster in einem bestimmten Bereich. | |||
Als nächstes muß die interne Organisation der Agents geklärt werden. MINSKY führt diese als Analogon zur hierarchisch abstrahierenden Organisation des visuellen Systems ein: | |||
"... information can only move upwards, on the whole. This is what one might imagine for the lower levels of a visual system: simple feature or texture detectors a the bottom, above them edge and region sensing agents, and identifiers of more specific objects or images at higher levels."<ref>Minsky (1980) S.120 f</ref> | |||
Dieser Aufbau führt seiner Ansicht entsprechend zu einer prinzipiell pyramidenähnlichen Organisation sensorischer Systeme.Jede eintreffende Information kann so als ein raum-zeitliches Muster, besser: als ein sich nach oben bewegender partieller mentaler Zustand gedacht werden. Je nach Höhe liegt die Information dann in verschiedenen Abstraktionsstufen vor. | |||
Aktiviert man diese Pyramide auf irgendeinem Bereich, dann resultiert daraus ein partieller mentaler Zustand, der je nach Breite der Aktivation einem Sinneseindruck variabler Intensität entspricht.<ref>Diese Idee findet sich bei HALGREN (1982) als bereits bestätigt. Dieser hatte durch elektrische Reizungen im Diencephalon lebhafte Erinnerungen auslösen können.</ref><ref>vgl. Kap.3: 'Wie'</ref> Wenn Gedächtnis eine Wiederholung von Sinnesreizen ermöglichen soll, dann muß irgendwie eine derartige Aktivierung infolge anderer Sinneseindrücke zustandekommen. | |||
Zu diesem Zweck postuliert MINSKY eine zweite Struktur, in der Information in der Gegenrichtung fließt, also von oben nach unten. | |||
Die Agents dieser Struktur heißen K-Nodes (K-Knoten), die Struktur entsprechend K-Pyramide. Anatomisch wird angenommen, daß K- und P-Pyramiden praktisch ineinander verflochten sind. Dadurch wird ermöglicht, daß direkte oder indirekte Verbindungen zwischen den Knoten beider Systeme gebildet werden. Diese Verbindungen sind die K-Lines! | |||
Im Regelfall aktiviert dabei ein K-Knoten mehrere P-Knoten in einem der Höhe nach begrenzten Bereich. Denkt man sich nun eine Verbindung eines P-Knotens in den oberen Regionen der Pyramide, die Wahrnehmung einer Problemsituation etwa, mit einem ähnlich positionierten K-Knoten, der die erfolgreiche Lösungssituation einer ähnlichen Aufgabe zu reproduzieren vermag, dann ist das System perfekt. | |||
Genau an dieser Stelle aber sind die präzisen Ausführungen MINSKYs zu Ende. Fairerweise weist er denn Leser auf diesen Umstand hin: | |||
"... from this point on, the reader can assume that difficulties in understanding are my fault, not his."<ref>Minsky (1980) S.125</ref> Da dieser Mangel nicht die Organisation, sondern lediglich den Prozess der Speicherung tangiert, will ich MINSKYs Spekulationen über das mögliche Zustandekommen einer solchen P-->K Verbindung nur kurz beschreiben: | |||
Wie bei komplexen Beziehungen nicht anders zu erwarten, muß auch hier die Vermittlung von einer weiteren Instanz abhängig gemacht werden. MINSKY nennt diese weitere Struktur N-Pyramide. Diese besteht aus einer Anordnung von Zielen, die in ihrer Gesamtheit als Pläne fungieren. Diese Struktur soll nun entscheiden, wann welcher P-Knoten mit welchem K-Knoten verknüpft werden soll. | |||
Diese Vorstellung bereitet außerordentliche Probleme, wenn ein unendlicher Regress vermieden werden soll. Wer soll z.B. diese Struktur steuern? Zudem wird die Beziehung zum anfangs noch gegenwärtigen neurologischen Substrat mit dieser neuen Struktur fallengelassen, es sei denn, man wollte wirklich einen real existierenden Homunculus in Kopf haben. | |||
Abgesehn davon bietet die vorgeschlagene Organisation des Gedächtnisses Erklärungsmöglichkeiten für eine Reihe von Phänomenen, nachdem MINSKY folgende Prämisse eingeführt hat: | |||
Agents auf einem gegebenen Niveau sind nicht gemeinsam aktivierbar. Das Prinzip der 'cross-exclusion' besagt, daß alle Agents eines Niveaus sich mittels lateraler Hemmung gegenseitig auszuschalten in der Lage sind. Dieses Ausschalten resultiert in einem Verschwinden der Informationen auf einem Niveau. Da dieses Prinzip nur laterale Auswirkungen hat, kann sich dieses Konkurrieren auf jedem Abstraktionsniveau wiederholen. Das System sucht sozusagen den 'größten gemeinsamen Teiler' zweier Informationen auf gleicher Modalität (= in derselben Pyramide!). | |||
Mit diesem Prinzip sind sowohl logische Operationen wie Negation, Disjunktion usw. als auch mengentheoretische Operationen wie Obermengenbildung und dergleichen mehr vorstellbar. | |||
Eine Bestätigung dieses Mechanismus glaubt MINSKY in Experimenten PIAGETs zum Erwerb von Konstanzphänomenen bei Kindern gefunden zu haben. Die Herleitung dieser Beziehung ist hier von geringem Interesse, da aus Introspektion und Alltagserfahrung alleine genügend Beispiele bezogen werden können. | |||
| permanentes | Aktivierung | plastische Ef- | 1) visuelles | | |||
| (Langzeit-) | von K-Lines | ferenzen simu- | System | | |||
| Gedächtnis | ====> | lieren afferen-| 2) Graphen- | | |||
| >>Engramme<< | alte Situation| te Muster nach | theorie | | |||
| | wird simuliert| 'Bedarf' (?) | 3) Radioröhre | | |||
Der Ansatz von MINSKY vereinigt drei bislang voneinander getrennt behandelte Gebiete: Dispositionen (1), Neuroanatomie (2) und kognitive Prozesse (3). | |||
Die Verknüpfung aller drei scheint mir nicht ganz freiwillig vonstatten gegangen zu sein. Um eine plausible Darstellung von Information in einem anatomisch gegebenen Rahmen zu erreichen, mußte MINSKY Gefühle als legitime Form von Information zulassen. Deren Operationalisierung als Dispositionen eines Netzwerks gewisser Einheiten bildet die Grundlage, Speicherung auf der Basis veränderter Struktur plausibel zu machen. | |||
Durch diese Plausibilität aber handelt sich MINSKY auch Probleme ein, die eine steuernde Instanz betreffen: | |||
Als Gedächtnissubstrat dienen nicht die Knoten der P-Pyramide, sondern die K-Lines bzw. die K-Pyramide. Daß diese Struktur sich in irgendeiner Weise zweckgerichtet verhält, ist solange banal, als nicht klar wird, wie diese Zweckgerichtetheit zustandekommt. | |||
Den Mechanismus auf eine dritte Struktur zu verlagern, ist in dieser Hinsicht keine ausreichende Lösung. Dazu kommt, daß diese N-Pyramide nicht mehr auf das anatomische Substrat bezogen wird. Mit dem Verlust dieser Basis fällt ein Hauptträger der Plausibilität dieses Ansatzes in sich zusammen. | |||
Begreift man den Ansatz infolgedessen als vom Substrat entkoppelt, dann resultiert eine Abwandlung von SAM, dem Ansatz von RAAIJMAKERS und SHIFFRIN. Diese Verwandschaft ist freilich nicht besonders eng: | |||
Während SAM bereits gut alleine laufen kann, tun sich die K-Lines noch recht schwer - damit überhaupt etwas läuft, brauchen diese noch einen 'dritten Mann'. | |||
Die kausale Transformation aktiver K-Lines in reproduzierte oder simulierte Situationen, bietet schließlich dieselbe Angriffsfläche für das ROSE-Argument wie schon eine Reihe von Ansätzen zuvor. Daß bei einer Reproduktion irgendetwas im ZNS aktiv sein muß, ist zwingend. Daß es ausgerechnet K-Lines sein sollen, ist dagegen weniger überzeugend, zumal ihre Herkunft bzw. die ihrer 'Arbeitsbefehle' noch immer im Dunkeln liegt. | |||
Zusammen mit neurowissenschaftlichen Experimenten wie denen von HALGREN bestünde eine prinzipielle Chance, etwas mehr über diese Zusammenhänge zu erfahren, mindestens aber die, etwas über Legitimation und Herkunft der K-Lines zu erfahren. | |||
</font> | </font> | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2025, 15:02 Uhr
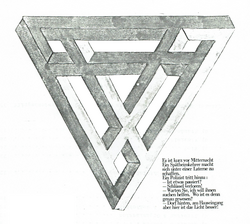
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Pyramiden
"A complex system that works is invariably found to have evolved from a simple system that works."
Mit diesem Absatz aus MURPHYs Technologie-Gesetzen sind die Besonderheiten der Gedächtnistheorie von Marvin MINSKY gegenüber den bisher in diesem Kapitel referierten Ansätzen gut charakterisiert. MINSKY weist ganz entschieden auf die ontogenetischen Aspekte von Gedächtnisprozessen hin:
"I doubt that human memory has the same uniform, invariant character throughout development, and do not want to attribute to infants capacities that develop only later. (118) ... one must not assume that "concrete" recollections are basically the simplest; that is an illusion reflecting the enormous competence of the adult mental systems ... (119) ... attitudes do really precede propositions, feelings come before facts. This seems strange only because we cannot remember what we knew in infancy. (120)"[1]
Über die nicht gänzlich unplausible Prämisse einer qualitativen Ontogenese von Informationsrepräsentationen erreicht MINSKY eine Verschiebung der Prioritäten von Propositionen zu Dispositionen. Damit steht er keineswegs alleine; Patrick RABBITT beispielsweise muß etwas Ähnliches gemeint haben, wenn er über Gedächtnismodelle schreibt:
"... next there was the "filter" which bogged down whole generations of research workers who took it for a coffee strainer rather than for the tuned resonator ist plainly is."[2] Wie dieser Resonator 'getuned' wird, d.h. wie eine Disposition in diesem Sinne zustandekommt, klingt recht einfach:
Wenn man ein Problem löst, eine Idee oder ein (be)merkenswertes Erlebnis hat, wird eine sogenannte 'K-Line' erzeugt. Diese K-Line verbindet alle 'mentalen Einheiten' die inzwischen aktiv waren. Wird sie später reaktiviert, so erzeugt sie einen 'partiellen mentalen Zustand', indem sie einige dieser mentalen Einheiten reaktiviert und das Ereignis so teilweise reproduziert.
Die Terminologie dieser Darstellung erfordert, daß MINSKY sich in irgendeiner Weise auf das neurologische Substrat von Gedächtnis bezieht. Tatsächlich versucht er, eine Systematisierung der Anatomie zu leisten, die eine Speicherung mittels struktureller Variationen erlaubt. Die wichtigste dieser Variationen ist die Erzeugung von K-Lines. Um diese Systematisierung genügend durchschaubar zu machen, bedarf es zunächst einer Klärung der oben eingeführten Begriffe. Minsky erledigt all das in einem Akt.
- Das ZNS ist für ihn eine Gesellschaft vieler kleiner, relativ autonomer Einheiten die er als 'Agents' bezeichnet. Die Organisation dieser Gesellschaft wird in drei Punkten definiert:
- Eine erste grobe Einteilung richtet sich nach Funktionen wie Reizverarbeitung, Sprache, Planung, usw.
- Diese Bereiche bestehen aus einzelnen Agents (s.o.), von von denen jedes mit einer Zustandsänderung auf bestimmte Reizmuster reagiert. Diese erfüllen somit die Funktion von Feature-Detektoren.
- Die möglichen Zustände sind im Minimalfall nur zwei: aktiv oder inaktiv. Ein mentaler Zustand wird so definiert als Muster aller zu einem Zeitpunkt aktiven Agents; ein partieller mentaler Zustand bezeichnet analog dazu ein Muster in einem bestimmten Bereich.
Als nächstes muß die interne Organisation der Agents geklärt werden. MINSKY führt diese als Analogon zur hierarchisch abstrahierenden Organisation des visuellen Systems ein:
"... information can only move upwards, on the whole. This is what one might imagine for the lower levels of a visual system: simple feature or texture detectors a the bottom, above them edge and region sensing agents, and identifiers of more specific objects or images at higher levels."[3]
Dieser Aufbau führt seiner Ansicht entsprechend zu einer prinzipiell pyramidenähnlichen Organisation sensorischer Systeme.Jede eintreffende Information kann so als ein raum-zeitliches Muster, besser: als ein sich nach oben bewegender partieller mentaler Zustand gedacht werden. Je nach Höhe liegt die Information dann in verschiedenen Abstraktionsstufen vor.
Aktiviert man diese Pyramide auf irgendeinem Bereich, dann resultiert daraus ein partieller mentaler Zustand, der je nach Breite der Aktivation einem Sinneseindruck variabler Intensität entspricht.[4][5] Wenn Gedächtnis eine Wiederholung von Sinnesreizen ermöglichen soll, dann muß irgendwie eine derartige Aktivierung infolge anderer Sinneseindrücke zustandekommen.
Zu diesem Zweck postuliert MINSKY eine zweite Struktur, in der Information in der Gegenrichtung fließt, also von oben nach unten.
Die Agents dieser Struktur heißen K-Nodes (K-Knoten), die Struktur entsprechend K-Pyramide. Anatomisch wird angenommen, daß K- und P-Pyramiden praktisch ineinander verflochten sind. Dadurch wird ermöglicht, daß direkte oder indirekte Verbindungen zwischen den Knoten beider Systeme gebildet werden. Diese Verbindungen sind die K-Lines!
Im Regelfall aktiviert dabei ein K-Knoten mehrere P-Knoten in einem der Höhe nach begrenzten Bereich. Denkt man sich nun eine Verbindung eines P-Knotens in den oberen Regionen der Pyramide, die Wahrnehmung einer Problemsituation etwa, mit einem ähnlich positionierten K-Knoten, der die erfolgreiche Lösungssituation einer ähnlichen Aufgabe zu reproduzieren vermag, dann ist das System perfekt.
Genau an dieser Stelle aber sind die präzisen Ausführungen MINSKYs zu Ende. Fairerweise weist er denn Leser auf diesen Umstand hin:
"... from this point on, the reader can assume that difficulties in understanding are my fault, not his."[6] Da dieser Mangel nicht die Organisation, sondern lediglich den Prozess der Speicherung tangiert, will ich MINSKYs Spekulationen über das mögliche Zustandekommen einer solchen P-->K Verbindung nur kurz beschreiben:
Wie bei komplexen Beziehungen nicht anders zu erwarten, muß auch hier die Vermittlung von einer weiteren Instanz abhängig gemacht werden. MINSKY nennt diese weitere Struktur N-Pyramide. Diese besteht aus einer Anordnung von Zielen, die in ihrer Gesamtheit als Pläne fungieren. Diese Struktur soll nun entscheiden, wann welcher P-Knoten mit welchem K-Knoten verknüpft werden soll.
Diese Vorstellung bereitet außerordentliche Probleme, wenn ein unendlicher Regress vermieden werden soll. Wer soll z.B. diese Struktur steuern? Zudem wird die Beziehung zum anfangs noch gegenwärtigen neurologischen Substrat mit dieser neuen Struktur fallengelassen, es sei denn, man wollte wirklich einen real existierenden Homunculus in Kopf haben.
Abgesehn davon bietet die vorgeschlagene Organisation des Gedächtnisses Erklärungsmöglichkeiten für eine Reihe von Phänomenen, nachdem MINSKY folgende Prämisse eingeführt hat:
Agents auf einem gegebenen Niveau sind nicht gemeinsam aktivierbar. Das Prinzip der 'cross-exclusion' besagt, daß alle Agents eines Niveaus sich mittels lateraler Hemmung gegenseitig auszuschalten in der Lage sind. Dieses Ausschalten resultiert in einem Verschwinden der Informationen auf einem Niveau. Da dieses Prinzip nur laterale Auswirkungen hat, kann sich dieses Konkurrieren auf jedem Abstraktionsniveau wiederholen. Das System sucht sozusagen den 'größten gemeinsamen Teiler' zweier Informationen auf gleicher Modalität (= in derselben Pyramide!).
Mit diesem Prinzip sind sowohl logische Operationen wie Negation, Disjunktion usw. als auch mengentheoretische Operationen wie Obermengenbildung und dergleichen mehr vorstellbar.
Eine Bestätigung dieses Mechanismus glaubt MINSKY in Experimenten PIAGETs zum Erwerb von Konstanzphänomenen bei Kindern gefunden zu haben. Die Herleitung dieser Beziehung ist hier von geringem Interesse, da aus Introspektion und Alltagserfahrung alleine genügend Beispiele bezogen werden können.
| permanentes | Aktivierung | plastische Ef- | 1) visuelles | | (Langzeit-) | von K-Lines | ferenzen simu- | System | | Gedächtnis | ====> | lieren afferen-| 2) Graphen- | | >>Engramme<< | alte Situation| te Muster nach | theorie | | | wird simuliert| 'Bedarf' (?) | 3) Radioröhre |
Der Ansatz von MINSKY vereinigt drei bislang voneinander getrennt behandelte Gebiete: Dispositionen (1), Neuroanatomie (2) und kognitive Prozesse (3).
Die Verknüpfung aller drei scheint mir nicht ganz freiwillig vonstatten gegangen zu sein. Um eine plausible Darstellung von Information in einem anatomisch gegebenen Rahmen zu erreichen, mußte MINSKY Gefühle als legitime Form von Information zulassen. Deren Operationalisierung als Dispositionen eines Netzwerks gewisser Einheiten bildet die Grundlage, Speicherung auf der Basis veränderter Struktur plausibel zu machen.
Durch diese Plausibilität aber handelt sich MINSKY auch Probleme ein, die eine steuernde Instanz betreffen:
Als Gedächtnissubstrat dienen nicht die Knoten der P-Pyramide, sondern die K-Lines bzw. die K-Pyramide. Daß diese Struktur sich in irgendeiner Weise zweckgerichtet verhält, ist solange banal, als nicht klar wird, wie diese Zweckgerichtetheit zustandekommt.
Den Mechanismus auf eine dritte Struktur zu verlagern, ist in dieser Hinsicht keine ausreichende Lösung. Dazu kommt, daß diese N-Pyramide nicht mehr auf das anatomische Substrat bezogen wird. Mit dem Verlust dieser Basis fällt ein Hauptträger der Plausibilität dieses Ansatzes in sich zusammen.
Begreift man den Ansatz infolgedessen als vom Substrat entkoppelt, dann resultiert eine Abwandlung von SAM, dem Ansatz von RAAIJMAKERS und SHIFFRIN. Diese Verwandschaft ist freilich nicht besonders eng:
Während SAM bereits gut alleine laufen kann, tun sich die K-Lines noch recht schwer - damit überhaupt etwas läuft, brauchen diese noch einen 'dritten Mann'.
Die kausale Transformation aktiver K-Lines in reproduzierte oder simulierte Situationen, bietet schließlich dieselbe Angriffsfläche für das ROSE-Argument wie schon eine Reihe von Ansätzen zuvor. Daß bei einer Reproduktion irgendetwas im ZNS aktiv sein muß, ist zwingend. Daß es ausgerechnet K-Lines sein sollen, ist dagegen weniger überzeugend, zumal ihre Herkunft bzw. die ihrer 'Arbeitsbefehle' noch immer im Dunkeln liegt.
Zusammen mit neurowissenschaftlichen Experimenten wie denen von HALGREN bestünde eine prinzipielle Chance, etwas mehr über diese Zusammenhänge zu erfahren, mindestens aber die, etwas über Legitimation und Herkunft der K-Lines zu erfahren.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ Minsky,M. (1980): K-Lines: A theory of memory.
- ↑ Rabbitt,P. (1984): Simplistic heuristics and Maltese acrostics. S.78
- ↑ Minsky (1980) S.120 f
- ↑ Diese Idee findet sich bei HALGREN (1982) als bereits bestätigt. Dieser hatte durch elektrische Reizungen im Diencephalon lebhafte Erinnerungen auslösen können.
- ↑ vgl. Kap.3: 'Wie'
- ↑ Minsky (1980) S.125