Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Assoziativspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984}} <font size="3" face="Gothic"> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} </font> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}}“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | ||
;Assoziativspeicher | |||
Ein Ansatz, der die Selbstimmunisierung der beiden zuvor referierten Ansätze zu vermeiden sucht, stammt von Jeroen G. RAAIJMAKERS und Richard M. SHIFFRIN<ref>Raaijmakers,J.G.W. & Shiffrin,R.M. (1980): SAM: A theory of probabilistic search of associative memory. Raaijmakers,J.G.W. & Shiffrin,R.M. (1981): Search of associative memory.</ref>. | |||
Diese haben den Wunsch nach einer Realisierung ihres Modells als Software und, damit verknüpft, die Formalisierung mittels Graphentheorie aufgegeben. R & S betonen in ihrem Ansatz den Mechanismus von Suchprozessen - das Etikett SAM steht für 'Search of Associative Memory' - für den Netzwerke der oben beschriebenen Art als Basis ungeeignet erscheinen. | |||
Damit eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Dieser Wechsel besteht in der Annahme eines Netzwerks aus vielerlei Attributen. Prinzipiell kann jedes Attribut als mit jedem anderen verbunden betrachtet werden; die Intensität dieser Verbindungen ist variabel. Zur Plausibilität dieser Idee fehlen noch zwei Prämissen: | |||
#Die Knoten des ASN und des HAM (s.o.) können als Komplex verknüpfter Attribute begriffen werden; scharfe Grenzen gibt es keine mehr; | |||
#Irgendwelche Objekte sind deshalb als Menge von Attributen mit relativ starken internen Verbindungen charakterisiert. | |||
Der Perspektivenwechsel besteht demnach in einer Verfeinerung der zugrundegelegten Organisation von Information. Verglichen mit ASN und HAM arbeitet der hypothetische Mechanismus von SAM über Mikrostrukturen von Information. | |||
R & S schlagen die Terme 'Feature' für Attribute und 'Image' für einen Komplex von Attributen vor. | |||
Die Stärke der Verbindung zweier im Gedächtnis befindlicher Objektrepräsentationen 'A' und 'B' kann so als Summe der beteiligten Attributverbindungen, wiederum gewichtet nach Stärke, definiert werden. Damit wird gleichzeitig die problematische Annahme deterministischer Verbindungen gegen die flexiblere Annahme probabilistischer Verbindungen ausgetauscht: Der Betrag der summierten Attributassoziationen zwischen zwei Repräsentationen entspricht der Warscheinlichkeit, daß die Vorgabe von 'A' die Reproduktion von 'B' bewirkt. | |||
Da auch hier die Assoziation als tragendes Element der Gedächtnisrepräsentation auftaucht, sollte die Frage nach dem Prozeß der Einprägung als bereits behandelt gelten dürfen. - Trotzdem nochmal: | |||
Informationserwerb besteht auch für R & S in der Bildung neuer Assoziationen. Dies geschieht im Prinzip bereits bei gleichzeitigem Auftreten von Repräsentationen im KZS. Durch aktive Steuerprozesse wie Rehearsal, Bewertung oder sonstige Aufmerksamkeitszuwendung kann dieser Effekt noch verstärkt werden. | |||
In dieser Hinsicht ist der Ansatz noch als konventionell zu bezeichnen. | |||
Etwas anders sollte es bei den Abrufmechanismen aussehen: Das Etikett SAM betont diesen Aspekt schließlich ganz besonders. | |||
Die tragende Rolle beim Abruf gespeicherter Information spielen Cues<ref>vgl. 'Paradigmen' im Überblick zu diesem Kapitel</ref>. Wirksame Cues zeichnen sich durch eine relativ große Anzahl gemeinsamer Features mit gespeicherter Information aus. Dies führt zu einer Reproduktion des LZS-Fragments, das die größte Zahl gemeinsamer Features mit dem Cue aufweist. Da der Cue aber immer von einem Kontext umrahmt ist, hängt seine Wirksamkeit auch von diesem ab. Als Folge davon kann derselbe Cue zu verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Repräsentationen wachrufen. | |||
Was letztlich reproduziert wird, ist zu einem beträchtlichen Teil als zufällig anzusehen. Im Gegenzug ist die Reproduktion der gewünschten Information immer mit einem Warscheinlichkeitswert behaftet. | |||
Diese Warscheinlichkeit kann bei hinreichend überschaubarem Material, wie im Fall des FR-Paradigmas, aus Parametern wie Listenlänge, Kapazität eines Rehearsal-Puffers usw. berechnet werden. Auf diese Weise gelangt man beispielsweise zu einer simulierten seriellen Positionskurve, die sich mit einer empirisch mittels gleicher Parameter gefundenen vergleichen läßt. Externe Parameter wie Listenlänge etc. sind hierbei unproblematisch. Interne Parameter wie die Rehearsalkapazität müssen einer diesbezüglichen Theorie entsprechend eingesetzt werden. Daß deren empirische Ermittlung besonders im Falle mehrerer sich gegenseitig kompensierender Parameter prinzipiell mit Schwierigkeiten behaftet ist, haben CRAIK und LOCKHART bereits im Jahre 1972 dokumentiert<ref>vgl. 'L.o.P.' in diesem Kapitel</ref>. Unklar bleibt daher, ob und inwieweit Abweichungen von Prognosen und Empirie durch Variation von Parametern kompensiert werden können. In diesem Fall würde sich der Ansatz wie die beiden vorigen dem Vorwurf der Beliebigkeit preisgeben, wie ihn S.P.R. ROSE erhebt. | |||
| permanentes | N gemeinsamer | 'spreading ac- | 1) Gesetz der | | |||
| (Langzeit-) | Features | tivation': die | Ekphorie von | | |||
| Gedächtnis | ====> | Menge an Fea- | R. SEMON<ref>R.Semon (1909): Die mnemischen Empfindungen.</ref> | | |||
| >>Engramme<< | Warsch. der | ture-Relation- | 2) Ähnlich- | | |||
| | Reproduktion | en best. Repr. | keitsmaße | | |||
Auffallend bei diesem Ansatz ist seine ausgesprochene Ähnlichkeit mit den Assoziativspeicheransätzen aus Kapitel 3. Diese 'Fast-Äquivalenz' wäre perfekt, wenn sich die Features aus SAM mit einzelnen Neuronen identifizieren ließen. Ob dies legitim ist, kann beim gegenwärtigen Stand der Forschung werder bejaht noch vollständig ausgeschlossen werden<ref>vgl. Kap.3: 'Synapsen'; insbesondere den Ansatz von COOPER und IMBERT.</ref>. | |||
Der Umstand, daß sich beide Ansätze auf SEMONs Gesetz der Ekphorie zurückführen lassen, darf nicht zum Anlaß genommen werden, ihre Identität quasi als latent gegeben zu betrachten - schließlich hatten Primaten und Menschen auch dieselben Ahnen! | |||
Die zweite Quelle von SAM bezieht sich direkt auf die dort zugrundegelegte Organisation: | |||
Statistische Ähnlichkeitsmaße bestehen, im Prinzip analog zur Gesamtassoziation zwischen Images, aus einer Summe von Resultaten zweistelliger Funktionen: | |||
Ähnlichkeit = Summe(F(xi,yi)) | |||
Legt man die Vorstellung einer nach allen Seiten sich auswirkenden Aktivierung zugrunde, was im SAM der Fall ist, dann werden letzten Endes die N Images aktiviert, bei denen die meisten und/oder stärksten Verbindungen enden. Die Möglichkeit einer auf diese Weise vorstellbaren Eigendynamik des Gedächtnisses wird von R & S leider nicht diskutiert. | |||
In der dargestellten Form bietet der Ansatz aber bereits plausible Erklärungsmöglichkeiten zur differentiellen Wirksamkeit von Cues. | |||
Wie durch die kausale Transformation angezeigt, handelt es sich beim SAM um einen paramorphes Modell, d.h. aus dem hypothetischen Mechanismus sind Phänomene an der Oberfläche kausal ableitbar. | |||
Obwohl die Organisation der Informationsrepräsentation im SAM nur zur Formulierung eines Abrufmechanismus dient, sollten daraus doch weitere Hypothesen über Gedächtnisphänomene ableitbar sein. Im folgenden Abschnitt wird es, zumindest implizit, um solche existentiellen Hypothesen gehen. | |||
</font> | </font> | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2025, 14:44 Uhr
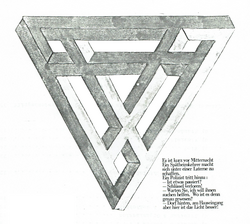
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Assoziativspeicher
Ein Ansatz, der die Selbstimmunisierung der beiden zuvor referierten Ansätze zu vermeiden sucht, stammt von Jeroen G. RAAIJMAKERS und Richard M. SHIFFRIN[1].
Diese haben den Wunsch nach einer Realisierung ihres Modells als Software und, damit verknüpft, die Formalisierung mittels Graphentheorie aufgegeben. R & S betonen in ihrem Ansatz den Mechanismus von Suchprozessen - das Etikett SAM steht für 'Search of Associative Memory' - für den Netzwerke der oben beschriebenen Art als Basis ungeeignet erscheinen.
Damit eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Dieser Wechsel besteht in der Annahme eines Netzwerks aus vielerlei Attributen. Prinzipiell kann jedes Attribut als mit jedem anderen verbunden betrachtet werden; die Intensität dieser Verbindungen ist variabel. Zur Plausibilität dieser Idee fehlen noch zwei Prämissen:
- Die Knoten des ASN und des HAM (s.o.) können als Komplex verknüpfter Attribute begriffen werden; scharfe Grenzen gibt es keine mehr;
- Irgendwelche Objekte sind deshalb als Menge von Attributen mit relativ starken internen Verbindungen charakterisiert.
Der Perspektivenwechsel besteht demnach in einer Verfeinerung der zugrundegelegten Organisation von Information. Verglichen mit ASN und HAM arbeitet der hypothetische Mechanismus von SAM über Mikrostrukturen von Information.
R & S schlagen die Terme 'Feature' für Attribute und 'Image' für einen Komplex von Attributen vor.
Die Stärke der Verbindung zweier im Gedächtnis befindlicher Objektrepräsentationen 'A' und 'B' kann so als Summe der beteiligten Attributverbindungen, wiederum gewichtet nach Stärke, definiert werden. Damit wird gleichzeitig die problematische Annahme deterministischer Verbindungen gegen die flexiblere Annahme probabilistischer Verbindungen ausgetauscht: Der Betrag der summierten Attributassoziationen zwischen zwei Repräsentationen entspricht der Warscheinlichkeit, daß die Vorgabe von 'A' die Reproduktion von 'B' bewirkt.
Da auch hier die Assoziation als tragendes Element der Gedächtnisrepräsentation auftaucht, sollte die Frage nach dem Prozeß der Einprägung als bereits behandelt gelten dürfen. - Trotzdem nochmal:
Informationserwerb besteht auch für R & S in der Bildung neuer Assoziationen. Dies geschieht im Prinzip bereits bei gleichzeitigem Auftreten von Repräsentationen im KZS. Durch aktive Steuerprozesse wie Rehearsal, Bewertung oder sonstige Aufmerksamkeitszuwendung kann dieser Effekt noch verstärkt werden.
In dieser Hinsicht ist der Ansatz noch als konventionell zu bezeichnen.
Etwas anders sollte es bei den Abrufmechanismen aussehen: Das Etikett SAM betont diesen Aspekt schließlich ganz besonders.
Die tragende Rolle beim Abruf gespeicherter Information spielen Cues[2]. Wirksame Cues zeichnen sich durch eine relativ große Anzahl gemeinsamer Features mit gespeicherter Information aus. Dies führt zu einer Reproduktion des LZS-Fragments, das die größte Zahl gemeinsamer Features mit dem Cue aufweist. Da der Cue aber immer von einem Kontext umrahmt ist, hängt seine Wirksamkeit auch von diesem ab. Als Folge davon kann derselbe Cue zu verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Repräsentationen wachrufen.
Was letztlich reproduziert wird, ist zu einem beträchtlichen Teil als zufällig anzusehen. Im Gegenzug ist die Reproduktion der gewünschten Information immer mit einem Warscheinlichkeitswert behaftet.
Diese Warscheinlichkeit kann bei hinreichend überschaubarem Material, wie im Fall des FR-Paradigmas, aus Parametern wie Listenlänge, Kapazität eines Rehearsal-Puffers usw. berechnet werden. Auf diese Weise gelangt man beispielsweise zu einer simulierten seriellen Positionskurve, die sich mit einer empirisch mittels gleicher Parameter gefundenen vergleichen läßt. Externe Parameter wie Listenlänge etc. sind hierbei unproblematisch. Interne Parameter wie die Rehearsalkapazität müssen einer diesbezüglichen Theorie entsprechend eingesetzt werden. Daß deren empirische Ermittlung besonders im Falle mehrerer sich gegenseitig kompensierender Parameter prinzipiell mit Schwierigkeiten behaftet ist, haben CRAIK und LOCKHART bereits im Jahre 1972 dokumentiert[3]. Unklar bleibt daher, ob und inwieweit Abweichungen von Prognosen und Empirie durch Variation von Parametern kompensiert werden können. In diesem Fall würde sich der Ansatz wie die beiden vorigen dem Vorwurf der Beliebigkeit preisgeben, wie ihn S.P.R. ROSE erhebt.
| permanentes | N gemeinsamer | 'spreading ac- | 1) Gesetz der | | (Langzeit-) | Features | tivation': die | Ekphorie von | | Gedächtnis | ====> | Menge an Fea- | R. SEMON[4] | | >>Engramme<< | Warsch. der | ture-Relation- | 2) Ähnlich- | | | Reproduktion | en best. Repr. | keitsmaße |
Auffallend bei diesem Ansatz ist seine ausgesprochene Ähnlichkeit mit den Assoziativspeicheransätzen aus Kapitel 3. Diese 'Fast-Äquivalenz' wäre perfekt, wenn sich die Features aus SAM mit einzelnen Neuronen identifizieren ließen. Ob dies legitim ist, kann beim gegenwärtigen Stand der Forschung werder bejaht noch vollständig ausgeschlossen werden[5].
Der Umstand, daß sich beide Ansätze auf SEMONs Gesetz der Ekphorie zurückführen lassen, darf nicht zum Anlaß genommen werden, ihre Identität quasi als latent gegeben zu betrachten - schließlich hatten Primaten und Menschen auch dieselben Ahnen!
Die zweite Quelle von SAM bezieht sich direkt auf die dort zugrundegelegte Organisation:
Statistische Ähnlichkeitsmaße bestehen, im Prinzip analog zur Gesamtassoziation zwischen Images, aus einer Summe von Resultaten zweistelliger Funktionen:
Ähnlichkeit = Summe(F(xi,yi))
Legt man die Vorstellung einer nach allen Seiten sich auswirkenden Aktivierung zugrunde, was im SAM der Fall ist, dann werden letzten Endes die N Images aktiviert, bei denen die meisten und/oder stärksten Verbindungen enden. Die Möglichkeit einer auf diese Weise vorstellbaren Eigendynamik des Gedächtnisses wird von R & S leider nicht diskutiert.
In der dargestellten Form bietet der Ansatz aber bereits plausible Erklärungsmöglichkeiten zur differentiellen Wirksamkeit von Cues.
Wie durch die kausale Transformation angezeigt, handelt es sich beim SAM um einen paramorphes Modell, d.h. aus dem hypothetischen Mechanismus sind Phänomene an der Oberfläche kausal ableitbar.
Obwohl die Organisation der Informationsrepräsentation im SAM nur zur Formulierung eines Abrufmechanismus dient, sollten daraus doch weitere Hypothesen über Gedächtnisphänomene ableitbar sein. Im folgenden Abschnitt wird es, zumindest implizit, um solche existentiellen Hypothesen gehen.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ Raaijmakers,J.G.W. & Shiffrin,R.M. (1980): SAM: A theory of probabilistic search of associative memory. Raaijmakers,J.G.W. & Shiffrin,R.M. (1981): Search of associative memory.
- ↑ vgl. 'Paradigmen' im Überblick zu diesem Kapitel
- ↑ vgl. 'L.o.P.' in diesem Kapitel
- ↑ R.Semon (1909): Die mnemischen Empfindungen.
- ↑ vgl. Kap.3: 'Synapsen'; insbesondere den Ansatz von COOPER und IMBERT.