Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Knoten und Kanten: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984}} <font size="3" face="Gothic"> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} </font> {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}}“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 4}} | ||
;Knoten und Kanten | |||
TULVINGs Unterscheidung eines episodischen und eines semantischen Gedächtnisses<ref>vgl. 'Überblick' in diesem Kapitel</ref> spielt in den eben referierten Prozessmodellen praktisch keine Rolle. Dies hat mindestens zwei Ursachen: | |||
#TULVINGs diesbezügliche Arbeit erschien 1972. Nur BROADBENTs Malteser Kreuz wurde nach diesem Zeitpunkt publiziert. | |||
#Die Prozessmodelle kommen ohne diese Unterscheidung aus. Assoziationen als Grundlage von Langzeitgedächtnis kommen sowohl für episodisch als auch für semantisch geordnete Information in Frage. | |||
Dabei ist es mit einer sematischen Trennung dieser beiden 'Speicher' noch nicht getan. Daß Interaktionen zwischen ihnen mindestens plausibel sind, zeigt ein Experiment von E.F. LOFTUS & G. ZANNI: | |||
Studenten wurden Filme von Verkehrsunfällen vorgeführt. Im Anschluß daran wurden ihnen Fragen über verschiedene darin vorgekommene Ereignisse gestellt, wobei sich diese Fragen für zwei Gruppen in einem Detail unterschieden. Die einen Fragen enthielten bestimmte, die anderen unbestimmte Artikel: "Hast Du DEN kaputten Scheinwerfer gesehen?", bzw. "Hast Du EINEN kaputten Scheinwerfer gesehen?" | |||
Als Ergebnis zeigten sich wesentlich mehr Ja-Antworten beim bestimmten als beim unbestimmten Artikel. | |||
Für LOFTUS & ZANNI manifestiert sich darin der Effekt des semantischen auf das episodische Gedächtnis: Aus dem semantischen Gedächtnis weiß man i.d.R., daß ein bestimmter Artikel die Existenz des folgenden Subjekts impliziert.<ref>vgl. Loftus & Loftus (1976) S.134 f</ref> In Ansätzen zur Klärung der Organisation von Langzeitgedächtnis muß darum mindestens die Trennung berücksichtigt werden. Eine Untersuchung der Interaktionen ist rein logisch erst nach erreichter Klarheit über die Organisation der beiden Speicher sinnvoll. In diesem Abschnitt geht es zunächst um Ansätze zur Organisation des semantischen Gedächtnisses. | |||
Glaubt man William A. WOODS, dann existierte bis zum Jahre 1975 keine Theorie semantischer Netzwerke: | |||
"I think we must begin with the realization that there is currently no "theory" of semantic networks. The notion of semantic networks is for the most part an attractive notion which has yet to be proven. Even the question of what networks have to do with semantics is one which takes some answering."<ref>Woods,W.A. (1975): What's in a link: Foundations for semantic networks. S.36</ref> | |||
Dies hinderte Allan COLLINS und Ross QUILLIAN sechs Jahre zuvor allerdings nicht daran, ein solches Netzwerk als Organisationsform anzunehmen. Die Grundlage dafür bildete in der Hauptsache die Annahme nichtredundanter Speicherung oder die einer 'kognitiven Ökonomie'.<ref>vgl. Loftus & Loftus (1976) S.124 f</ref> | |||
Erreicht wurde diese Ökonomie mittels eines hierarchisch geordneten Kategoriensystems; die Dimension der Ordnung bestand im Abstraktionsgrad der Kategorien. So mußte jedes Prädikat nur einmal gespeichert werden: In der Definition des maximal allgemeinen Kategorie. Im Prinzip sieht das folgendermaßen aus: | |||
TIER | |||
(ißt, hat Haut) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
+---------------+----------------+ | |||
| | | |||
| | | |||
VOGEL FISCH | |||
(hat Flügel, kann fliegen) (kann schwimmen, hat Kiemen) | |||
| | | |||
| | | |||
+------+-------+ +-------+---------+ | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
KANARIENVOGEL STORCH HAI LACHS | |||
(ist gelb, (ist weiß, (kann beißen, (ist rosa, | |||
kann singen) bringt Kinder) ist gefährlich) ist eßbar) | |||
Die empirische Überprüfung einer derartigen Organisation, basierend auf Knoten (Etikett mit Prädikaten-n-Tupel) und Kanten (Verbindungen von Knoten, hier: Obermengen-Relation), geht davon aus, daß: | |||
#Abruf von Information in einem 'Abfahren' der Kanten besteht; | |||
#jede Kante in etwa gleich lang ist. | |||
COLLINS & QUILLIAN fragten ihre Pbn also beispielsweise "Ist ein Kanarienvogel gelb?", "Kann ein Kanarienvogel fliegen?", oder "Ißt ein Kanarienvogel?". Die Antwortzeit sollte den obigen Annahmen zufolge eine Funktion der zu passierenden Kanten sein. | |||
C & Q fanden tatsächlich eine lineare (!) Beziehung von Kantenzahl und Antwortzeit. | |||
Natürlich sind solche Ergebnise noch kein Grund, die Sache als abgeschlossen zu betrachten. Wieder entsteht hier die Frage nach dem 'Wer': Die Organisation von Gedächtnisinhalten bleibt irrelevant, solange es einen Homunculus braucht, der die Information herauslesen muß. | |||
Donald A. NORMAN und David E. RUMELHART haben sich diesem Problem angenommen.<ref>Norman,D.A. & Rumelhart,D.E. (1975): Explorations in Cognition.</ref> Ähnlich wie später BROADBENT (s.o.) gehen auch sie von der Annahme aus, daß die Anweisungen, wie die aktuellen Verarbeitungsschritte auszusehen haben, sich im Langzeitgedächtnis befinden. | |||
Da ihr Netzwerk so zur benötigten Eigendynamik kommt, nennen sie es Aktives Strukturelles Netzwerk (ASN); die zugrundeliegende Arbeitshypothese heißt entsprechend 'one-system-hypothesis'. | |||
Dieses eine System umfaßt drei Bereiche: Die Datenbasis (1), Prozesse, die über dieser Datenbasis arbeiten aber selbst deren Bestandteile sind (2), und die Exekutive, die den Ablauf der Prozesse steuert (3). | |||
Ich will meine Darstellung hier auf die erste Komponente, d.h. auf die Datenbasis, beschränken. | |||
Die Datenbasis von N & R stellt eine Erweiterung des semantischen Netzwerks von COLLINS & QUILLIAN dar. Der Unterschied zu diesem besitzt drei wesentliche Aspekte: | |||
#Die Kanten im ASN bezeichnen eine Vielzahl verschiedener Relationen statt nur eine Obermengen-Relation bei C & Q; | |||
#Als Knoten werden neben Begriffen auch Verben zugelassen; | |||
#der Unterschied zwischen semantischem und episodischem Gedächtnis besteht für N & R lediglich in der Benennung der Kanten: semantisches Gedächtnis kommt mit 'hat'- und 'ist ein'-Kanten bzw. deren Inversen aus. | |||
N & R unterscheiden stattdessen Begriffsinhalte, Situationen und Prozesse; bei TULVING hießen die beiden letzten Kategorien episodisches Gedächtnis. Die 'one-system-hypothesis' präzisiert demnach die TULVINGsche Dichotomisierung als Trennung nach Inhalten (durch die Etikette der Kanten), statt nach Speichern. Die Vorstellung von Interaktionen zwischen beiden Modi wird dadurch wesentlich erleichtert. | |||
Die Aufteilung nach Begriffsinhalten, Situationen und Prozessen geschieht wieder mittels Obermengen-Relationen: | |||
Prozesse ñ Situationen ñ Begriffe ç ç ç | |||
Begriffsrepräsentationen basieren auf 'hat'- und 'ist ein'-Kanten und ihren Inversen. | |||
In Situationsrepräsentationen sind Handlungen mittels 'objekt'-, 'agent'- und 'rezipient'-Kanten etc. sowie 'Zeit'-Kanten einer Stufe (z.B. Vergangenheit) mit den entsprechenden Begriffen verbunden. | |||
Für Prozeßrepräsentationen benötigt man analog zusätzliche Kanten mehrerer zeitlicher Stufen und entsprechender Relationen zwischen diesen wie 'dann' oder 'während'. | |||
Wem die Komplexität der oben geschilderten Prozessrepräsentationen zu unhandlich und nach eingehender Introspektion zu wenig plausibel erscheint, der kann sie etwas reduzieren: | |||
Durch Anwendung einer Grammatik kann die Repräsentation in kurze Aussagen, oder Propositionen, zerlegt werden. | |||
John R. ANDERSON und Gordon H. BOWER bevorzugen diese Form der Darstellung.<ref>vgl. Anderson,J.R. & Bower,G.H. (1980): Human Associative Memory: A Brief Edition. S.79-99</ref> Ihre Ableitung basiert allerdings nicht auf dem Ansatz von N & R. Statt des Netzcharakters betonen A & B die assoziative Natur der Verknüpfung von Informationseinheiten. Ihr Ansatz, d.h. die daraus resultierende Software, trägt die Bezeichnung HAM für Human Associative Memory. Ebensowenig Zweifel lassen A & B über die Natur der Gedächtniseinheiten bestehen. - Propositionen erscheinen ihnen als geeignetstes Mittel zur Erfüllung von fünf Forderungen: | |||
#Alles, was Menschen formulieren oder verstehen können, muß darstellbar sein. | |||
#Trotz deS, als unbegrenzt angenommenen Speicherplatzes, sollen relativ schnelle Such- und Abrufprozesse möglich sein. | |||
#Die Repräsentation soll unabhängig von der speziellen Sprache möglich sein. Insbesondere soll kein Unterschied zwischen sensorischer und linguistischer Darstellung angenommen werden. | |||
#Zwecks Überschaubarkeit der Darstellung soll ein Minimum an formalen Kategorien benutzt werden. | |||
#Verlangt wird weiterhin eine einfache Darstellung der Konstruktion komplexer Inhalte aus einfachen Inhalten, wie Hierarchien, mehrstufige Prädikate, Prognosen, etc. | |||
Wie bereits angedeutet, führen diese Bedingungen bei A & B zur Annahme von Propositionen als Elemente des LZG. Über die formale Struktur von Propositionen herrscht weitgehend Übereinstimmung: Für A & B hat sich seit ARISTOTELES (!) die Unterscheidung von Subjekt (S) und Prädikat (P) als sinnvoll zur Darstellung von Propositionen erwiesen. Ein Element würde dann etwa folgendermaßen aussehen: | |||
S-----(p)-----P | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
John ist groß | |||
Die Minimalform einer Proposition benötigt also drei Knoten (p, 'John', 'ist groß') und zwei Kanten (S,P). | |||
Einige Probleme mehr macht die Definition dessen, was ein Prädikat alles sein darf. A & B benutzen den Term 'Prädikation eines Subjekts', womit alles zum Prädikat wird, was sich auf das Subjekt beziehen läßt; zwei neue Kanten werden eingeführt: Relation (R) und Objekt (O). | |||
S------(p1)--------P | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| R----(p2)----O | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | | | |||
John ist größer als Bill | |||
Eine weitere Prädikation dieser Struktur schafft bereits erste Zweideutigkeiten - bezieht sich die zweite Prädikation auf das erste Prädikat oder auf dessen Objekt? | |||
S------(p1)------PS------S--(p3)----P | |||
| |? ? | | |||
| |? ? | | |||
| |? ? | | |||
| O----(p2)----R? | | |||
| | |? | | |||
| | |? | | |||
| | |? | | |||
John Mary schlägt brutal | |||
Mit zunehmender Komplexität der zu erfassenden Information werden, ähnlich wie im ASN von NORMAN und RUMELHART, neue Etikette für die Kanten benötigt: 'Ursache', 'Zeit', 'Ort', 'Kontext', 'Faktum', usw. | |||
Die Darstellung erreicht dann ein Ausmaß an Komplexität, welches mit dem des vorigen Ansatzes durchaus konkurrieren kann. | |||
Sowohl beim ASN als auch beim HAM taucht eigentlich gleich die Frage auf, wie denn diese schöne Ordnung im Gedächtnis zustandekommt. Die Antwort darauf ist in beiden Ansätzen dieselbe; ich will darum erst jetzt am Schluß darauf eingehen. | |||
Wie in Forderung (iii) von A & B verlangt wird, soll die interne Repräsentation der Information unabhängig von deren natürlichsprachlicher Form erfolgen. Anders als in der Theorie dieser Ansätze, wo die Aufmerksamkeit den Knoten gilt, sind als relevante Einheiten der Repräsentation eher die Kanten gefragt. Deren Etikettierung stellt nämlich das Hauptproblem bei der theoretischen Formierung von Gedächtnisinhalten dar. | |||
Diese Aufgabe fällt einer Instanz namens 'Parser' zu, wobei A & B zwischen einem linguistischen und einem sensorischen Parser unterscheiden. Die Strategie des Parsers ist denkbar einfach, und keineswegs elegant. Aus einem 'Lexikon' sucht er zuerst die angetroffenen Worte heraus um deren Kategorie festzustellen. Aus dieser Information und der Position des Wortes wird dann dessen Funktion (d.h. das Etikett der Kante) ermittelt. Dies entspricht recht genau einer Satzanalyse auf der Grundlage einer natürlichsprachlichen Grammatik. | |||
Der Parser übernimmt so die Funktion eines Übersetzers von natürlicher Sprache in die angenommene interne Repräsentation. Für die Bewertung dieser Repräsentation kann er aber, dank seiner Universalität, außer Acht gelassen werden. | |||
| permanentes | Entfernung | Informations- | | | |||
| (Langzeit-) | im Netzwerk | erwerb durch | mathematische | | |||
| Gedächtnis | ====> | topologische | Graphen- | | |||
| >>Engramme<< | Antwortzeit | Addition von | theorie<ref>vgl. Harary,F., Norman,R.Z., Cartwright,D. (1965): Structural Models - An Introduction to the Theorie of directed Graphs.</ref> | | |||
| | bei Kombinat. | neuen Kanten | | | |||
Ansätze auf der Grundlage mathematischer Graphentheorie weisen ohne Zweifel einen hohen Grad an Plausibilität auf. Dies mag auf eine introspektiv vorgenommene ad hoc-Evaluation zurückzuführen sein. Empirisch sind sie jedoch kaum zu fassen: Die von COLLINS & QUILLIAN benutzte Methode der Antwortzeiten bei richtig/falsch-Urteilen ist faktisch die einzige Möglichkeit einer Kontrolle. Im Übrigen bleibt man auf die schon genannte Plausibilität verwiesen. | |||
Gleichwohl macht die kausale Transformation der Entfernung in Antwortzeiten die beiden Ansätze zu Modellen. | |||
Da beide Modelle besonderen Wert auf die Möglichkeit der Softwareimplementierung legen, können die Prioritäten der Autoren zu Ungunsten eines Modells menschlichen Gedächtnisses ausgefallen sein: "Hauptsache die Software ist in Ordnung". | |||
In jedem Fall trifft die beiden hier referierten Modelle der Vorwurf von S.P.R. ROSE: | |||
"The black boxes can be modelled to generate predictions as well as post hoc accounts. However, the problem with this type of abstract function-box modelling is that, whilst it may pass a theory test, it is likely to fail a reality test; an infinite number of models is always possible for any outcome, and failures can always be 'adjusted' by modifying parameters without changing basic design elements."<ref>vgl. dazu die ausführliche Darstellung dieser Position im Exkurs.</ref> | |||
</font> | </font> | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2025, 14:37 Uhr
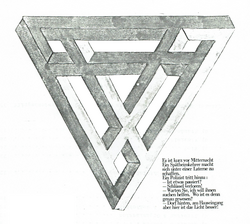
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Knoten und Kanten
TULVINGs Unterscheidung eines episodischen und eines semantischen Gedächtnisses[1] spielt in den eben referierten Prozessmodellen praktisch keine Rolle. Dies hat mindestens zwei Ursachen:
- TULVINGs diesbezügliche Arbeit erschien 1972. Nur BROADBENTs Malteser Kreuz wurde nach diesem Zeitpunkt publiziert.
- Die Prozessmodelle kommen ohne diese Unterscheidung aus. Assoziationen als Grundlage von Langzeitgedächtnis kommen sowohl für episodisch als auch für semantisch geordnete Information in Frage.
Dabei ist es mit einer sematischen Trennung dieser beiden 'Speicher' noch nicht getan. Daß Interaktionen zwischen ihnen mindestens plausibel sind, zeigt ein Experiment von E.F. LOFTUS & G. ZANNI:
Studenten wurden Filme von Verkehrsunfällen vorgeführt. Im Anschluß daran wurden ihnen Fragen über verschiedene darin vorgekommene Ereignisse gestellt, wobei sich diese Fragen für zwei Gruppen in einem Detail unterschieden. Die einen Fragen enthielten bestimmte, die anderen unbestimmte Artikel: "Hast Du DEN kaputten Scheinwerfer gesehen?", bzw. "Hast Du EINEN kaputten Scheinwerfer gesehen?"
Als Ergebnis zeigten sich wesentlich mehr Ja-Antworten beim bestimmten als beim unbestimmten Artikel.
Für LOFTUS & ZANNI manifestiert sich darin der Effekt des semantischen auf das episodische Gedächtnis: Aus dem semantischen Gedächtnis weiß man i.d.R., daß ein bestimmter Artikel die Existenz des folgenden Subjekts impliziert.[2] In Ansätzen zur Klärung der Organisation von Langzeitgedächtnis muß darum mindestens die Trennung berücksichtigt werden. Eine Untersuchung der Interaktionen ist rein logisch erst nach erreichter Klarheit über die Organisation der beiden Speicher sinnvoll. In diesem Abschnitt geht es zunächst um Ansätze zur Organisation des semantischen Gedächtnisses.
Glaubt man William A. WOODS, dann existierte bis zum Jahre 1975 keine Theorie semantischer Netzwerke:
"I think we must begin with the realization that there is currently no "theory" of semantic networks. The notion of semantic networks is for the most part an attractive notion which has yet to be proven. Even the question of what networks have to do with semantics is one which takes some answering."[3]
Dies hinderte Allan COLLINS und Ross QUILLIAN sechs Jahre zuvor allerdings nicht daran, ein solches Netzwerk als Organisationsform anzunehmen. Die Grundlage dafür bildete in der Hauptsache die Annahme nichtredundanter Speicherung oder die einer 'kognitiven Ökonomie'.[4]
Erreicht wurde diese Ökonomie mittels eines hierarchisch geordneten Kategoriensystems; die Dimension der Ordnung bestand im Abstraktionsgrad der Kategorien. So mußte jedes Prädikat nur einmal gespeichert werden: In der Definition des maximal allgemeinen Kategorie. Im Prinzip sieht das folgendermaßen aus:
TIER
(ißt, hat Haut)
|
|
|
+---------------+----------------+
| |
| |
VOGEL FISCH
(hat Flügel, kann fliegen) (kann schwimmen, hat Kiemen)
| |
| |
+------+-------+ +-------+---------+
| | | |
| | | |
KANARIENVOGEL STORCH HAI LACHS
(ist gelb, (ist weiß, (kann beißen, (ist rosa, kann singen) bringt Kinder) ist gefährlich) ist eßbar)
Die empirische Überprüfung einer derartigen Organisation, basierend auf Knoten (Etikett mit Prädikaten-n-Tupel) und Kanten (Verbindungen von Knoten, hier: Obermengen-Relation), geht davon aus, daß:
- Abruf von Information in einem 'Abfahren' der Kanten besteht;
- jede Kante in etwa gleich lang ist.
COLLINS & QUILLIAN fragten ihre Pbn also beispielsweise "Ist ein Kanarienvogel gelb?", "Kann ein Kanarienvogel fliegen?", oder "Ißt ein Kanarienvogel?". Die Antwortzeit sollte den obigen Annahmen zufolge eine Funktion der zu passierenden Kanten sein.
C & Q fanden tatsächlich eine lineare (!) Beziehung von Kantenzahl und Antwortzeit.
Natürlich sind solche Ergebnise noch kein Grund, die Sache als abgeschlossen zu betrachten. Wieder entsteht hier die Frage nach dem 'Wer': Die Organisation von Gedächtnisinhalten bleibt irrelevant, solange es einen Homunculus braucht, der die Information herauslesen muß.
Donald A. NORMAN und David E. RUMELHART haben sich diesem Problem angenommen.[5] Ähnlich wie später BROADBENT (s.o.) gehen auch sie von der Annahme aus, daß die Anweisungen, wie die aktuellen Verarbeitungsschritte auszusehen haben, sich im Langzeitgedächtnis befinden.
Da ihr Netzwerk so zur benötigten Eigendynamik kommt, nennen sie es Aktives Strukturelles Netzwerk (ASN); die zugrundeliegende Arbeitshypothese heißt entsprechend 'one-system-hypothesis'.
Dieses eine System umfaßt drei Bereiche: Die Datenbasis (1), Prozesse, die über dieser Datenbasis arbeiten aber selbst deren Bestandteile sind (2), und die Exekutive, die den Ablauf der Prozesse steuert (3).
Ich will meine Darstellung hier auf die erste Komponente, d.h. auf die Datenbasis, beschränken.
Die Datenbasis von N & R stellt eine Erweiterung des semantischen Netzwerks von COLLINS & QUILLIAN dar. Der Unterschied zu diesem besitzt drei wesentliche Aspekte:
- Die Kanten im ASN bezeichnen eine Vielzahl verschiedener Relationen statt nur eine Obermengen-Relation bei C & Q;
- Als Knoten werden neben Begriffen auch Verben zugelassen;
- der Unterschied zwischen semantischem und episodischem Gedächtnis besteht für N & R lediglich in der Benennung der Kanten: semantisches Gedächtnis kommt mit 'hat'- und 'ist ein'-Kanten bzw. deren Inversen aus.
N & R unterscheiden stattdessen Begriffsinhalte, Situationen und Prozesse; bei TULVING hießen die beiden letzten Kategorien episodisches Gedächtnis. Die 'one-system-hypothesis' präzisiert demnach die TULVINGsche Dichotomisierung als Trennung nach Inhalten (durch die Etikette der Kanten), statt nach Speichern. Die Vorstellung von Interaktionen zwischen beiden Modi wird dadurch wesentlich erleichtert.
Die Aufteilung nach Begriffsinhalten, Situationen und Prozessen geschieht wieder mittels Obermengen-Relationen:
Prozesse ñ Situationen ñ Begriffe ç ç ç
Begriffsrepräsentationen basieren auf 'hat'- und 'ist ein'-Kanten und ihren Inversen.
In Situationsrepräsentationen sind Handlungen mittels 'objekt'-, 'agent'- und 'rezipient'-Kanten etc. sowie 'Zeit'-Kanten einer Stufe (z.B. Vergangenheit) mit den entsprechenden Begriffen verbunden.
Für Prozeßrepräsentationen benötigt man analog zusätzliche Kanten mehrerer zeitlicher Stufen und entsprechender Relationen zwischen diesen wie 'dann' oder 'während'.
Wem die Komplexität der oben geschilderten Prozessrepräsentationen zu unhandlich und nach eingehender Introspektion zu wenig plausibel erscheint, der kann sie etwas reduzieren:
Durch Anwendung einer Grammatik kann die Repräsentation in kurze Aussagen, oder Propositionen, zerlegt werden.
John R. ANDERSON und Gordon H. BOWER bevorzugen diese Form der Darstellung.[6] Ihre Ableitung basiert allerdings nicht auf dem Ansatz von N & R. Statt des Netzcharakters betonen A & B die assoziative Natur der Verknüpfung von Informationseinheiten. Ihr Ansatz, d.h. die daraus resultierende Software, trägt die Bezeichnung HAM für Human Associative Memory. Ebensowenig Zweifel lassen A & B über die Natur der Gedächtniseinheiten bestehen. - Propositionen erscheinen ihnen als geeignetstes Mittel zur Erfüllung von fünf Forderungen:
- Alles, was Menschen formulieren oder verstehen können, muß darstellbar sein.
- Trotz deS, als unbegrenzt angenommenen Speicherplatzes, sollen relativ schnelle Such- und Abrufprozesse möglich sein.
- Die Repräsentation soll unabhängig von der speziellen Sprache möglich sein. Insbesondere soll kein Unterschied zwischen sensorischer und linguistischer Darstellung angenommen werden.
- Zwecks Überschaubarkeit der Darstellung soll ein Minimum an formalen Kategorien benutzt werden.
- Verlangt wird weiterhin eine einfache Darstellung der Konstruktion komplexer Inhalte aus einfachen Inhalten, wie Hierarchien, mehrstufige Prädikate, Prognosen, etc.
Wie bereits angedeutet, führen diese Bedingungen bei A & B zur Annahme von Propositionen als Elemente des LZG. Über die formale Struktur von Propositionen herrscht weitgehend Übereinstimmung: Für A & B hat sich seit ARISTOTELES (!) die Unterscheidung von Subjekt (S) und Prädikat (P) als sinnvoll zur Darstellung von Propositionen erwiesen. Ein Element würde dann etwa folgendermaßen aussehen:
S-----(p)-----P
| |
| |
| |
John ist groß
Die Minimalform einer Proposition benötigt also drei Knoten (p, 'John', 'ist groß') und zwei Kanten (S,P).
Einige Probleme mehr macht die Definition dessen, was ein Prädikat alles sein darf. A & B benutzen den Term 'Prädikation eines Subjekts', womit alles zum Prädikat wird, was sich auf das Subjekt beziehen läßt; zwei neue Kanten werden eingeführt: Relation (R) und Objekt (O).
S------(p1)--------P
| |
| |
| |
| R----(p2)----O
| | |
| | |
| | |
John ist größer als Bill
Eine weitere Prädikation dieser Struktur schafft bereits erste Zweideutigkeiten - bezieht sich die zweite Prädikation auf das erste Prädikat oder auf dessen Objekt?
S------(p1)------PS------S--(p3)----P
| |? ? |
| |? ? |
| |? ? |
| O----(p2)----R? |
| | |? |
| | |? |
| | |? |
John Mary schlägt brutal
Mit zunehmender Komplexität der zu erfassenden Information werden, ähnlich wie im ASN von NORMAN und RUMELHART, neue Etikette für die Kanten benötigt: 'Ursache', 'Zeit', 'Ort', 'Kontext', 'Faktum', usw.
Die Darstellung erreicht dann ein Ausmaß an Komplexität, welches mit dem des vorigen Ansatzes durchaus konkurrieren kann.
Sowohl beim ASN als auch beim HAM taucht eigentlich gleich die Frage auf, wie denn diese schöne Ordnung im Gedächtnis zustandekommt. Die Antwort darauf ist in beiden Ansätzen dieselbe; ich will darum erst jetzt am Schluß darauf eingehen.
Wie in Forderung (iii) von A & B verlangt wird, soll die interne Repräsentation der Information unabhängig von deren natürlichsprachlicher Form erfolgen. Anders als in der Theorie dieser Ansätze, wo die Aufmerksamkeit den Knoten gilt, sind als relevante Einheiten der Repräsentation eher die Kanten gefragt. Deren Etikettierung stellt nämlich das Hauptproblem bei der theoretischen Formierung von Gedächtnisinhalten dar.
Diese Aufgabe fällt einer Instanz namens 'Parser' zu, wobei A & B zwischen einem linguistischen und einem sensorischen Parser unterscheiden. Die Strategie des Parsers ist denkbar einfach, und keineswegs elegant. Aus einem 'Lexikon' sucht er zuerst die angetroffenen Worte heraus um deren Kategorie festzustellen. Aus dieser Information und der Position des Wortes wird dann dessen Funktion (d.h. das Etikett der Kante) ermittelt. Dies entspricht recht genau einer Satzanalyse auf der Grundlage einer natürlichsprachlichen Grammatik.
Der Parser übernimmt so die Funktion eines Übersetzers von natürlicher Sprache in die angenommene interne Repräsentation. Für die Bewertung dieser Repräsentation kann er aber, dank seiner Universalität, außer Acht gelassen werden.
| permanentes | Entfernung | Informations- | | | (Langzeit-) | im Netzwerk | erwerb durch | mathematische | | Gedächtnis | ====> | topologische | Graphen- | | >>Engramme<< | Antwortzeit | Addition von | theorie[7] | | | bei Kombinat. | neuen Kanten | |
Ansätze auf der Grundlage mathematischer Graphentheorie weisen ohne Zweifel einen hohen Grad an Plausibilität auf. Dies mag auf eine introspektiv vorgenommene ad hoc-Evaluation zurückzuführen sein. Empirisch sind sie jedoch kaum zu fassen: Die von COLLINS & QUILLIAN benutzte Methode der Antwortzeiten bei richtig/falsch-Urteilen ist faktisch die einzige Möglichkeit einer Kontrolle. Im Übrigen bleibt man auf die schon genannte Plausibilität verwiesen.
Gleichwohl macht die kausale Transformation der Entfernung in Antwortzeiten die beiden Ansätze zu Modellen.
Da beide Modelle besonderen Wert auf die Möglichkeit der Softwareimplementierung legen, können die Prioritäten der Autoren zu Ungunsten eines Modells menschlichen Gedächtnisses ausgefallen sein: "Hauptsache die Software ist in Ordnung".
In jedem Fall trifft die beiden hier referierten Modelle der Vorwurf von S.P.R. ROSE:
"The black boxes can be modelled to generate predictions as well as post hoc accounts. However, the problem with this type of abstract function-box modelling is that, whilst it may pass a theory test, it is likely to fail a reality test; an infinite number of models is always possible for any outcome, and failures can always be 'adjusted' by modifying parameters without changing basic design elements."[8]
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ vgl. 'Überblick' in diesem Kapitel
- ↑ vgl. Loftus & Loftus (1976) S.134 f
- ↑ Woods,W.A. (1975): What's in a link: Foundations for semantic networks. S.36
- ↑ vgl. Loftus & Loftus (1976) S.124 f
- ↑ Norman,D.A. & Rumelhart,D.E. (1975): Explorations in Cognition.
- ↑ vgl. Anderson,J.R. & Bower,G.H. (1980): Human Associative Memory: A Brief Edition. S.79-99
- ↑ vgl. Harary,F., Norman,R.Z., Cartwright,D. (1965): Structural Models - An Introduction to the Theorie of directed Graphs.
- ↑ vgl. dazu die ausführliche Darstellung dieser Position im Exkurs.