Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Wo: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 3}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 TOC 3}} | ||
;Wo? | |||
Obwohl die ersten ((i)-(iii)) der inhaltlichen Fragen aus dem Überblick durch die oben referierten Ansätze relativ gut abgedeckt sind, bleiben diejenigen, nach Modalitäten und Sitz des Gedächtnisses ((iv)-(vi)) noch außen vor. | |||
Ein Grund hierfür ist ganz gewiß der, daß die Hinweise auf den Sitz des Gedächtnisses vorwiegend von pathologischen Fällen aus der Humanmedizin stammen. Diese werden meist an anderen Orten untersucht als Plattwürmer, Bienen, Mäuse, Küken undsoweiter. | |||
Alle Syndrome, die dabei im Zentrum des Interesses stehen, haben natürlich irgendetwas mit Amnesie zu tun. Zwei Einzelfälle und zwei Fallgruppen dienen gewöhnlich als Informationsquellen: | |||
#Das Korsakow-Syndrom: Patienten mit dem Korsakow-Syndrom stellen die größte Gruppe von Amnestikern dar. Die Krankheit ist eine Folge von chronischem Alkoholmißbrauch, in selteneren Fällen auch von Encephalitis, und ist durch symmetrische Schäden entlang dem dritten und vierten Ventrikel, sowohl im Großhirn als auch im Kleinhirn, charakterisiert. Dadurch entsteht eine Reihe von kognitiven Defiziten, sowie eine unverhältnismäßig stark ausgebildete Amnesie. Nach dem akuten Stadium der Krankheit ist der 'Korsakow-Patient' wieder aufmerksam, konzentriert und weist normale intellektuelle Fähigkeiten auf, soweit diese durch die gängigen Tests erfaßt werden. | |||
#Elektro-Schock Patienten: Eine weitere Gruppe von Amnestikern bilden Patienten, die mittels 'Elektro-Schock-Therapie' (electroconvulsive therapy = ECT) gegen Depression 'behandelt' wurden. Als Folge dieser Behandlung tritt eine globale Amnesie ein, die über die Behandlungsstufen an Umfang zunimmt, und nach Absetzen der Behandlung allmählich verschwindet. Der besondere 'Vorzug' dieses amnestischen Syndroms ist, daß man jeden Patienten als seine eigene Kontroll-Person benützen kann. | |||
#Fall H.M.: Eine außerordentlich bedeutende Rolle spielen einzelne klinische Fälle, die aufgrund eines Unfalls oder einer Operation am ZNS zu Amnestikern wurden. Bei Fall H.M. wurde versucht eine ernste, irreparable Epilepsie durch einen chirurgischen Eingriff zu mildern. Dabei wurden beidseitig die vorderen zwei Drittel des Hippocampus, die Amygdalae sowie einige unmittelbar daran angrenzende weitere Strukturen des limbischen Systems entfernt. Als Folge dieser Operation stellte sich bei H.M. eine tiefgreifende Amnesie, ohne feststellbare Veränderungen der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit, ein. | |||
#Fall N.A.: Der zweite prominente Amnestiker ist das Opfer eines Unfalls mit einem Miniatur-Degen. Spätere Untersuchungen konnten die dadurch verursachte Verletzung im Bereich des linken dorsomedialen Thalamuskerns (der Thalamus liegt im Zwischenhirn = Diencephalon) lokalisieren. In Einklang mit diesem Befund zeigten neuropsychologische Studien, daß die Amnesie von N.A. sich stärker bei verbalem als bei nonverbalem Material auswirkt. Auch bei N.A. sind außer der Amnesie keine weiteren kognitiven oder sozialen Defizite als Folge der Verletzung aufgetreten - N.A.'s Intelligenz-Quotient liegt nach wie vor bei 124. | |||
Außer den ECT-Patienten weisen alle Fälle darauf hin, daß im Diencephalon irgendwelche Prozesse ablaufen, die von fundamentaler Bedeutung für das Gedächtnis sind. Aber nicht nur dies. Freda NEWCOMBE umreißt die Aussagekraft klinischer Daten folgendermaßen: | |||
"They have underscored the critical role of temporal lobes and hippocampus, the existence of material-specific (verbal vs. non-verbal) deficits, the possibility of modality-specific memory deficits, the sharp dissociation of short-term and long-term memory in different pathologies, and the relative independence of motor learning. It is not necessary to labour the point that these data contribute both clues and constraints to the design of a working model of memory in man."<ref>Newcombe,F. (1980): Memory: a neuropsychological approach. S.179f</ref> | |||
Zur Demonstration dieser 'clues and constraints' will ich den Fall einer weitgehend modalitätsunabhängigen (Frage (v)) Unterscheidung zweier 'Species' von Gedächtnis skizzieren: | |||
Den Anstoß dazu lieferte die Tatsache, daß Amnestiker unter bestimmten Bedingungen Lernleistungen erbringen, die mit denen normaler Vpn durchaus vergleichbar sind. Die am Besten studierten Beispiele für bei Amnesie erhaltener Lernfähigkeit, stammen aus dem Bereich der senso-motorischen Fertigkeiten: | |||
TALLAND<ref>Talland,G. (1969) nach Newcombe,F. (1980) S.180</ref> berichtet von einem Patienten, der für ein Klinik-Konzert gelernt hatte, eine Sänger auf dem Flügel zu begleiten, danach aber nicht mehr wußte, wie er das gelernt hatte. | |||
COHEN & SQUIRE<ref>Cohen,N.J. & Squire,L.R. (1980) nach Squire,L.R. (1982) S.259</ref> haben bei Vergleichen von N.A., K.P. und ECT-Patienten ein weiteres Beispiel gefunden: | |||
Amnestiker und normale Vpn bekamen die Aufgabe, Gruppen von Wörtern zu lesen, die durch einen Spiegel seitlich verkehrt worden waren. Die Amnestiker verbesserten ihre Fertigkeiten über drei Tage hinweg mit normalen Zuwachsraten und hielten diese auch nach sechs Monaten noch auf einem normalen Niveau, obwohl sie sich weder an Einzelheiten der Testsituation, noch an die dabei gelesenen Worte erinnern konnten. | |||
Ihre Ergebnisse veranlaßten COHEN & SQUIRE zur Unterscheidung von Information über Regeln oder Prozeduren (Handlungswissen), und solcher, die sich auf spezielle Einzeheiten oder Daten bezieht (Faktenwissen). Dies entspricht älteren Einteilungen gespeicherter Information in z.B. 'Wissen Wie' vs. 'Wissen Was' von RYLE.<ref>Ryle,G. (1949) nach Squire,L.R. (1982) S.260</ref> | |||
Die zuvor beschriebenen Tatsachen scheinen jetzt zu bestätigen, daß das Nervensystem dieselbe Unterscheidung trifft, d.h. daß diese beiden Bereiche der Information von grundsätzlich verschiedenen neuronalen Strukturen gespeichert werden. | |||
COHEN<ref>vgl. Cohen,N.J. (1981) nach Squire,L.R. (1982) S.260</ref> hat die Brauchbarkeit dieser Unterscheidung für die Erforschung der neuronalen Organisation des Gedächtnisses genauer untersucht. Er betrachtet Handlungswissen als 'implizites' Wissen, das nur durch Benutzung zugänglich ist. Viele Fertigkeiten (Musik, Sport, etc.) erfordern bei der Ausübung kein Erinnern an Orte und Zeiten bei denen sie verbessert oder erworben wurden. Solche, in der Vergangenheit liegenden, Handlungsereignisse ändern die Regeln nach denen der Organismus reagiert, hinterlassen demnach 'Spuren', sind aber dem direkten Zugriff nicht zugänglich. Das kritische Merkmal des Handlungswissens ist hierbei, daß: | |||
"there can develop in memory a representation based on experience that changes the way the organism responds to the environment, without affording access to the specific instances that led to this change. Accordingly, procedural learning applies to more than just the acquisition of motor skills."<ref>Squire,L.R. (1982) S.260</ref> | |||
Ganz sicher kein Zufall ist es darum, wenn sich Eric HALGREN und G.A. OJEMANN diencephalische Strukturen für ihre Stimulationsexperimente ausgesucht haben.<ref>Halgren,E.: Mental Phenomena Induced by Stimulation in the Limbic System. Ojemann,G.A.: Models of the Brain Organization for Higher Integrative Functions Derived with Electrical Stimulation Techniques.</ref> Eine Reihe von Hinweisen auf modalitätsspezische Speicherung (Frage (iv)) beispielsweise findet sich in HALGRENs Ergebnissen: | |||
*Stimulation beliebiger Bereiche des Limbischen Systems erzeugt Gefühle, hauptsächlich Angst. | |||
*werden der Hippocampus oder die Amygdalae stimuliert, berichten die Vpn von lebhaften Halluzinationen oder starken 'deja vu' Erlebnissen. | |||
*Bewegungsabläufe können durch Stimulation des Gyrus Cinguli provoziert werden. | |||
HALGREN berichtet auch ein Ergebnis, das COOPER & IMBERT<ref>vgl. Cooper,L.N. & Imbert,M. (1981)</ref> mittels ihres formalisierten visuellen Systems in ähnlicher Form gefunden hatten: | |||
Der spezielle Erlebnisinhalt ist unabhängig von der genauen Position der Reizelektrode. Was erlebt wird scheint eher mit der allgemeinen Stimmung oder Haltung der Vpn zusammenzuhängen. Eine direkte Beziehung zwischen einzelnen Neuronen und mentalen Inhalten existiert nicht. | |||
COOPER & IMBERT hatten in ihren Computersimulationen gefunden, daß die Spezialisierung von Units<ref>der Term 'Unit' bezieht sich auf die symbolischen Neuronen in den Simulationen von C & I , vgl. 'Wie? - Synapsen!' in diesem Kapitel</ref> unabhängig von der Modellstruktur ist: Nach Verlust der Spezialisierung infolge zeitweiliger Verringerung des Rauschabstands, konnte sich das Unit auf ein ganz anderes Muster spezialisieren. Es hing demnach von der Geschichte der visuellen Stimulationen ab, worauf die Neuronen letztendlich reagierten. | |||
Hinweise darauf, wie die Organisation innerhalb des Diencephalons aussehen könnte, stammen wieder aus der Pathologie: | |||
Elliott D. ROSS<ref>Ross,E.D. (1982): Disorders of recent memory in humans.</ref> hat verschiedene amnestische Syndrome aus der Literatur hinsichtlich ihrer anatomischen Befunde verglichen. Dabei zeigte sich, daß bestimmte Verletzungen zu scharf abgrenzbaren modalitätsspezifischen anterograden Amnesien führen. Dies kann prinzipiell zwei Ursachen haben: | |||
#Die Verletzungen liegen in Bereichen, die für eine modalitätsspezifische Speicherung zuständig sind. Das wäre ein Hinweis auf eine Trennung der Sinne, analog zur Unterscheidung von Handlungswissen vs. Faktenwissen (s.o.) die u.a. von SQUIRE & COHEN getroffen wurde. | |||
#Denkbar ist auch, daß der Informationszufluß bestimmter Modalitäten in eine, nur für Faktenwissen zuständige, Gedächtnisregion durch die Verletzungen unterbrochen wurde. Eine solche Instanz müßte Projektionen aus verschiedenen sensorischen Arealen, beispielsweise des Neocortex erhalten. | |||
Eine eingehende Betrachtung der anatomischen Befunde weist die zweite Alternative als die warscheinlichere aus. ROSS beschreibt z.B. den Fall einer eng begrenzten Amnesie: | |||
Nach einem Umzug in ein neues Drei-Zimmer-Appartment hatte dieser Patient große Schwierigkeiten sich darin zurechtzufinden. Jedesmal, wenn er in ein anderes Zimmer gehen wollte, mußte er seine Wohnung sprichwörtlich erforschen als ob er sich das erste Mal darin befände. | |||
Besuchte dieser Patient seine Eltern, in deren Wohnung er aufgewachsen war, hatte er keine derartigen Probleme. Es handelte sich also um eine anterograde visuelle Amnesie. | |||
E.G. JONES und T.P.S. POWELL<ref>vgl. Jones,E.G. & Powell,T.P.S. (1970) nach Ross,E.D. (1982) S.171</ref> haben die Bahnen der verschiedenen sensorischen Cortices innerhalb einer Hemisphäre bei Affen kartiert, und dadurch gezeigt, daß diese alle konvergierend in die infero-medialen Temporallappen projizieren. | |||
Der anatomische Befund des eben geschilderten Falls zeigt, daß hier die Projektionen aus dem primären visuellen Cortex verletzt sind. | |||
Erkenntnisse dieser Art haben die 'Endstation' der konvergierenden Projektionen der primären sensorischen Cortices in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. | |||
Nicht zuletzt durch die totalen Amnesien, wie die von Fall H.M., ist der Hippocampus (HC) zum Gegenstand zahlreicher Theorien und experimenteller Arbeiten im Bereich der Gedächtnisforschung geworden.<ref>Drachman,D.A. & Hughes,J.R. (1971): Memory and the Hippocampal Complexes. Cotman,C.W. & Nadler,J.V. (1978): Reactive Synaptogenesis in the Hippocampus. Halgren,E. Babb,T.L. Crandall,P.H. (1978): Activity of Human Hippocampal Formation and Amygdala Neurons During Memory Testing. Olton,D.S., Becker,J.T., Handelmann,G.E. (1979): Hippocampus, Space and Memory. O'Keefe,J. & Nadel,L. (1979): The Hippocampus as a Cognitive Map (Multiple Book Review). Sahgal,A. (1980): Functions of the Hippocampal System.</ref> Nach dem sich die Verwirrung über die tatsächliche(n) Funktion(en) dieser Struktur gelegt hatte, herrscht nun weitgehend Einigkeit darüber, daß der Hippocampus eine tragende Funktion bei bestimmten Gedächtnisprozessen innehat.<ref>vgl. Morris,R. (1982): New approaches to learning and memory. Sahgal,A. (1980): Functions of the hippocampal system.</ref> | |||
Wie diese Prozesse organisiert sind, wie die Information repräsentiert ist und welche Ausfälle bei Läsionen am HC zu erwarten sind, ist noch Gegenstand von Forschung und engagierter Auseinandersetzung. Mindestens zwei grundsätzlich verschiedene Positionen lassen sich bislang unterscheiden: | |||
D.S. OLTON J.T. BECKER und G.E. HANDELMANN<ref>Olton,D.S., Becker,J.T., Handelmann,G.E. (1979): Hippocampus, Space and Memory.</ref> vertreten die Position, der HC sei ein Arbeitsgedächtnis und mit der Speicherung räumlicher Proportionen betraut. Diese Annahme basiert auf Experimenten mit Ratten in sternförmigen Achtarmlabyrinthen. Die Tiere müssen lernen aus jedem Arm eine Futterpille zu holen, ohne in einen bereits durchlaufenen Arm zu gehen. HC-Läsionen haben einen vernichtenden Effekt auf dieses Verhalten. Nach OLTONs Ansicht, gibt es außerhalb des HC ein weiteres Gedächtnissystem, das er als 'reference memory' bezeichnet. Dort sollen Verhaltensweisen gespeichert sein, die sofort und ohne Modifikation auf eine Situation anwendbar seien. Eine Verletzung des HC dürfte demnach keine Auswirkung auf solche Verhaltensweisen haben. | |||
Die bisherigen Befunde scheinen diese Position zu tragen. | |||
TOLMANs Konzept der 'cognitive map' haben sich J. O'KEEFE und L. NADEL zur Grundlage ihrer Position gemacht. Das stärkste Argument dafür stammt aus 'single-unit-recordings' von sich frei bewegenden Ratten: Einzelne Zellen sind nur aktiv, wenn sich das Tier an einem bestimmten Ort befindet. HC-Läsionen haben in Ergänzung zu dieser Beobachtung den Effekt, daß die Tiere sich keine Orte mehr, wohl aber Schlüsselreize merken können. | |||
Diese Theorie will ich etwas ausführlicher referieren. | |||
Das Konzept der 'Cognitive Map' (CM) ermöglicht die Integration von vier unabhängig voneinander beobachteten Phänomenen: | |||
#Die Existenz sogenannter 'ortscodierter' Neuronen (s.o.) in freilaufenden Ratten und Kaninchen. | |||
#Die Beziehung von Bewegung der Ratte und Theta-Rhytmus im HC derselben. | |||
#Das Fehlen von Ortslernen und Erkundungsverhalten bei Tieren mit HC-Läsionen. | |||
#Die tiefgreifenden Amnesien bei Menschen nach Verletzungen des HC. | |||
Sehr viel Aufmerksamkeit verwenden O'KEEFE & NADEL auf die klare Definition ihrer Begriffe. Da es sich um ein Gedächtnissystem handeln soll, welches der räumlichen Abbildung der Umwelt dient, enthält ihr Ansatz eine Diskussion verschiedener Raum-Theorien und damit zusammenhängend, eine Gegenüberstellung von euklidischer und nicht-euklidischen Geometrien. | |||
Auch die TOLMANsche Definition einer Cognitive Map ist ihnen nicht präzis genug. Um diesen Begriff scharf erfassen zu können, postulieren sie zwei Systeme die der räumlichen Orientierung dienen: | |||
*'taxon'-Systeme speichern durch den Aufbau eines Kategoriensystems auf der Basis von Abstraktion und Generalisierung. Zwei Begriffe liegen umso näher beieinander je mehr ihrer physikalischen Pendants sich gleichen. Die Güte der Speicherung hängt von der Anzahl der Wiederholungen des jeweiligen Reizes ab. Mithilfe eines solchen Systems kann ein Tier zwei Strategien zur räumlichen Orientierung, sogenannte Route-Strategien, entwickeln: | |||
**Guidance-Hypothesen identifizieren Objekte oder 'cues', denen sich das Tier nähern kann bzw. die es vermeiden sollte. | |||
**Orientierungs-Hypothesen sind die Information darüber, wie sich das Tier zu orientieren hat, also eine Präzisierung der Guidance-Hypothesen. Genau handelt es sich bei diesen Informationen um Bewegungsvorschriften in einem egozentrischen räumlichen Koordinatensystem, dessen Ursprung und Achsen mit den Augen, dem Kopf oder mit dem Körper zusammenfallen können. | |||
*'locale'-Systeme - In einem Locale-System werden Informationen nicht nach Ähnlichkeit wie in einem Taxon-System, sondern entsprechend ihrer räumlich vorfindbaren Relationen zueinander gespeichert; das Lokale-System konstruiert eine Kopie der Umwelt. Dies ist der Begriff einer Cognitive Map von O'KEEFE & NADEL. Ein Lokale-System besitzt die folgenden kritischen Attribute: | |||
**Die Abbildung erfolgt durch schrittweises Hinzufügen von Elementen aus der Umgebung nach einem Alles-oder-Nichts-Prinzip; | |||
**es gibt nur schwache Interferenzen zwischen ähnlichen Objekten, da sie an verschiedenen Orten abgebildet werden; | |||
**die Güte der Speicherung wird durch mehrmaliges Aufsuchen eines Ortes kaum verändert, da es ja viele verschiedene Wege zu ihm gibt; | |||
**das Abbildungssystem ermöglich ein Agieren auf Entfernung, falls Start und Ziel auf derselben Abbildung repräsentiert sind. | |||
Da sich das Hauptaugenmerk der beiden Autoren auf die Konstruktion einer räumlichen Abbildung der Umwelt richtet, will ich an dieser Stelle etwas auf den hypothetischen Mechanismus und seine Grundlagen zu sprechen kommen: | |||
;Anatomie des HC | |||
Intern kann der HC in drei Bereiche untergliedert werden: Die Fascia Dentata, CA3 und CA1. Jedes dieser Systeme besteht aus einer Anordnung ähnlicher Projektionszellen sowie einer Anzahl Interneurone. | |||
Der Haupstrom der Information entspricht dieser Reihenfolge, wobei die Projektionen außerordentlich genau sind. | |||
;Afferenzen des HC | |||
Der HC bezieht seine Information aus zwei Quellen: Vom entorhinalen Cortex (eC) einerseits und vom medialen Septum und dem Hirnstamm andererseits. | |||
Der eC erhält viel Information von den sensorischen Arealen des Neocortex. Es ist daher anzunehmen, daß der HC auf diesem Weg bereits gut integrierte Information über die Umgebung erhält. Anatomische und physiologische Untersuchungen haben gezeigt, daß die Projektionen aus dem eC in den HC genauso exakt geführt sind, wie die innerhalb des HC. | |||
Die aus dem Hirnstamm eintreffende Information verteilt sich dagegen sehr viel diffuser. Es besteht Grund zu der Annahme, daß diese unspezifisch verteilte Information mit dem Auftreten des Theta-Rhytmus im HC zusammenhängt. Da der Hirnstamm durch Bewegungen des Tieres aktiviert wird, könnte der HC auf diese Weise zu Informationen über den Bewegungszustand kommen. | |||
;Theta-Rhytmus | |||
Die Funktion der Theta-Wellen läßt sich am besten als Ordnungsfunktion bezeichnen. Angenommen, die Erregbarkeit der Granulocytendendriten schwankt in eben diesem Theta-Rhytmus, dann kommt ihm die Funktion eines Kreuzkorrelators oder eines Synchronisators zu. | |||
;Theta und Verhalten | |||
Theta-Wellen treten vorwiegend im Laufe willkürlicher Bewegungen auf; bei unwillkürlichen Bewegungen dagegen, zeigt das HC-EEG starke und unregelmäßige Spitzen. Nimmt man an, daß die spezielle Frequenz der Theta-Wellen mit der Fortbewegungsgeschwindigkeit des Tieres kovariiert, dann würden die räumlichen Gegebenheiten entsprechend ihrer Distanz sortiert. | |||
;zwei Sorten HC-Zellen | |||
Single-Unit-Recordings aus dem HC deuten auf zwei Sorten von Zellen hin: 'Theta-Zellen' und 'ortscodierende Zellen'. | |||
Die ortscodierenden Zellen sind jene, die nur in einer ganz bestimmten Umgebung aktiv sind. Innerhalb dieser Gruppe lassen sich wiederum sogenannte 'place' und 'misplace' Zellen unterscheiden. Das sind Detektoren, die entweder das Fehlen oder das Vorhandensein bestimmter Reize anzeigen. | |||
Die Aktivität der Theta-Zellen ist kongruent mit dem HC-Theta-Rhytmus und besitzt auch dieselben Verhaltenskorrelate. | |||
Soweit das Modell der Cognitive Map von O'KEEFE & NADEL in der Theorie. | |||
Zur Beurteilung der Brauchbarkeit haben O & N eine Reihe unterschiedlichster Lernparadigmen an Ratten ohne HC ausprobiert. In kurzen Stichworten sehen die Ergebnisse folgendermaßen aus: | |||
#Explorationsverhalten: Keine systematische Erforschung Erforschung der Umgebung mehr -> keine Abbildung möglich. | |||
#Diskriminationslernen: Keine Benutzung lokaler Hypothesen. | |||
#diskriminatives Umkehrtraining: Nicht eindeutig - Ratten und Katzen haben Probleme, während bei Affen kein Effekt zu sehen ist. | |||
#komplexe Labyrinthe: Schlechtere Ergebnisse als normale Ratten. | |||
#Vermeidungslernen | |||
##one-way: gibt man einen CS als Cue, dann findet sich kein Unterschied. | |||
##two-way: Ohne HC besser -> kein Lernen des 'sicheren' Orts. | |||
##passiv: Keine Vermeidung des Orts aber sobald Guidance-Hypothesen (Cues) möglich sind Vermeidung. | |||
#Konditionierung | |||
##klassisch: Keine Effekte. | |||
##operant: normalerweise keine Effekte - aber: wenn lange Pausen zwischen dem Drücken eines Futterhebels verlangt werden, wissen Tiere ohne HC nicht wohin und drücken zu früh -> Futter weg. Mit einem Cue gibts keine Unterschiede mehr. | |||
#spatial delayed response und spatial alternation: Beides braucht räumliche Information -> Ohne HC geht nichts. | |||
#Extinktion: Ohne HC ist die Dauer stark erhöht. Kovariiert mit der Anzahl erfolgloser Versuche -> nur Taxon-System. | |||
#Frustration: keine Unterschiede - auch nicht bezüglich Aggression. | |||
#Sonstnochwas: Eine Anzahl indirekter Effekte auf Territorial- und Aufzuchverhalten - schwankt stark mit der experimentellen Technik. | |||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Modellevaluation | |||
|Phänomen=permanentes (Langzeit-)Gedächtnis >>Engramme<< | |||
|Transformationen=Bewegung und Informationsaufnahme ====> ortscodierte Neuronen | |||
|hypothetischer Mechanismus=Taktfrequenz steuert Verteilung der Information auf Zellen | |||
|Quellen=Digitaltechnologie | |||
}} | |||
Das oben analysierte Modell von O'KEEFE & NADEL ist nur eine Möglichkeit aus mehreren, die zahlreichen Befunde zum Sitz des Gedächtnisses in einem funktionellen Gedächtnismodell zu integrieren. Wegen seines stark spekulativen Charakters ist dieses Modell Ziel von Kritik gewesen, die sich vor allem gegen das dünne empirische Fundament richtete. | |||
Das ist genau der Grund weshalb ich es hier ausgesucht habe. Folgt man nämlich der Logik HARREs, so reicht bereits eine fixe Idee, um einen imposanten Paramorphismus zu konstruieren. | |||
Wie schon in den zuvor beschriebenen Modellen ist es auch hier praktisch unmöglich, alle Quellen zu rekonstruieren. Wenn mein Eindruck von der Digitaltechnologie als einer Quelle richtig ist, dann handelt es sich hier um einen Paramorphismus der völlig legitim zur Formulierung existentieller Hypothesen herangezogen werden kann. | |||
Der hypothetische Mechanismus ist auch in diesem Modell nicht vollständig geklärt. Der Grund mag darin liegen, daß O & N ihr Modell als Homomorphismus begreifen oder begriffen haben wollen. Dies zwingt sie, eventuell ungerechtfertigte Annahmen über die funktionale Organisation des HC erst gar nicht zu formulieren, was sich darüberhinaus noch als mangelnde Konsequenz und logische Inkonsistenz interpretieren läßt. | |||
Was bleibt, ist die Überprüfung der einzig möglichen existentiellen Hypothese: Gibt es eine Cognitive Map (Lokale-System)? | |||
Das umfangreiche empirische Datenmaterial scheint mir für eine Unterstützung dieser Hypothese gut geeignet zu sein. | |||
Was zu tun bleibt, ist, einen exakten Paramorphismus zu konstruieren, dessen hypothetischer Mechanismus unter Umständen noch eine Reihe weiterer Quellen erforderlich machen wird. | |||
</font> | </font> | ||
{{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | {{Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984 Footer}} | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2025, 17:46 Uhr
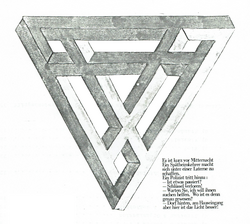
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Wo?
Obwohl die ersten ((i)-(iii)) der inhaltlichen Fragen aus dem Überblick durch die oben referierten Ansätze relativ gut abgedeckt sind, bleiben diejenigen, nach Modalitäten und Sitz des Gedächtnisses ((iv)-(vi)) noch außen vor.
Ein Grund hierfür ist ganz gewiß der, daß die Hinweise auf den Sitz des Gedächtnisses vorwiegend von pathologischen Fällen aus der Humanmedizin stammen. Diese werden meist an anderen Orten untersucht als Plattwürmer, Bienen, Mäuse, Küken undsoweiter.
Alle Syndrome, die dabei im Zentrum des Interesses stehen, haben natürlich irgendetwas mit Amnesie zu tun. Zwei Einzelfälle und zwei Fallgruppen dienen gewöhnlich als Informationsquellen:
- Das Korsakow-Syndrom: Patienten mit dem Korsakow-Syndrom stellen die größte Gruppe von Amnestikern dar. Die Krankheit ist eine Folge von chronischem Alkoholmißbrauch, in selteneren Fällen auch von Encephalitis, und ist durch symmetrische Schäden entlang dem dritten und vierten Ventrikel, sowohl im Großhirn als auch im Kleinhirn, charakterisiert. Dadurch entsteht eine Reihe von kognitiven Defiziten, sowie eine unverhältnismäßig stark ausgebildete Amnesie. Nach dem akuten Stadium der Krankheit ist der 'Korsakow-Patient' wieder aufmerksam, konzentriert und weist normale intellektuelle Fähigkeiten auf, soweit diese durch die gängigen Tests erfaßt werden.
- Elektro-Schock Patienten: Eine weitere Gruppe von Amnestikern bilden Patienten, die mittels 'Elektro-Schock-Therapie' (electroconvulsive therapy = ECT) gegen Depression 'behandelt' wurden. Als Folge dieser Behandlung tritt eine globale Amnesie ein, die über die Behandlungsstufen an Umfang zunimmt, und nach Absetzen der Behandlung allmählich verschwindet. Der besondere 'Vorzug' dieses amnestischen Syndroms ist, daß man jeden Patienten als seine eigene Kontroll-Person benützen kann.
- Fall H.M.: Eine außerordentlich bedeutende Rolle spielen einzelne klinische Fälle, die aufgrund eines Unfalls oder einer Operation am ZNS zu Amnestikern wurden. Bei Fall H.M. wurde versucht eine ernste, irreparable Epilepsie durch einen chirurgischen Eingriff zu mildern. Dabei wurden beidseitig die vorderen zwei Drittel des Hippocampus, die Amygdalae sowie einige unmittelbar daran angrenzende weitere Strukturen des limbischen Systems entfernt. Als Folge dieser Operation stellte sich bei H.M. eine tiefgreifende Amnesie, ohne feststellbare Veränderungen der allgemeinen intellektuellen Leistungsfähigkeit, ein.
- Fall N.A.: Der zweite prominente Amnestiker ist das Opfer eines Unfalls mit einem Miniatur-Degen. Spätere Untersuchungen konnten die dadurch verursachte Verletzung im Bereich des linken dorsomedialen Thalamuskerns (der Thalamus liegt im Zwischenhirn = Diencephalon) lokalisieren. In Einklang mit diesem Befund zeigten neuropsychologische Studien, daß die Amnesie von N.A. sich stärker bei verbalem als bei nonverbalem Material auswirkt. Auch bei N.A. sind außer der Amnesie keine weiteren kognitiven oder sozialen Defizite als Folge der Verletzung aufgetreten - N.A.'s Intelligenz-Quotient liegt nach wie vor bei 124.
Außer den ECT-Patienten weisen alle Fälle darauf hin, daß im Diencephalon irgendwelche Prozesse ablaufen, die von fundamentaler Bedeutung für das Gedächtnis sind. Aber nicht nur dies. Freda NEWCOMBE umreißt die Aussagekraft klinischer Daten folgendermaßen:
"They have underscored the critical role of temporal lobes and hippocampus, the existence of material-specific (verbal vs. non-verbal) deficits, the possibility of modality-specific memory deficits, the sharp dissociation of short-term and long-term memory in different pathologies, and the relative independence of motor learning. It is not necessary to labour the point that these data contribute both clues and constraints to the design of a working model of memory in man."[1]
Zur Demonstration dieser 'clues and constraints' will ich den Fall einer weitgehend modalitätsunabhängigen (Frage (v)) Unterscheidung zweier 'Species' von Gedächtnis skizzieren:
Den Anstoß dazu lieferte die Tatsache, daß Amnestiker unter bestimmten Bedingungen Lernleistungen erbringen, die mit denen normaler Vpn durchaus vergleichbar sind. Die am Besten studierten Beispiele für bei Amnesie erhaltener Lernfähigkeit, stammen aus dem Bereich der senso-motorischen Fertigkeiten:
TALLAND[2] berichtet von einem Patienten, der für ein Klinik-Konzert gelernt hatte, eine Sänger auf dem Flügel zu begleiten, danach aber nicht mehr wußte, wie er das gelernt hatte.
COHEN & SQUIRE[3] haben bei Vergleichen von N.A., K.P. und ECT-Patienten ein weiteres Beispiel gefunden:
Amnestiker und normale Vpn bekamen die Aufgabe, Gruppen von Wörtern zu lesen, die durch einen Spiegel seitlich verkehrt worden waren. Die Amnestiker verbesserten ihre Fertigkeiten über drei Tage hinweg mit normalen Zuwachsraten und hielten diese auch nach sechs Monaten noch auf einem normalen Niveau, obwohl sie sich weder an Einzelheiten der Testsituation, noch an die dabei gelesenen Worte erinnern konnten.
Ihre Ergebnisse veranlaßten COHEN & SQUIRE zur Unterscheidung von Information über Regeln oder Prozeduren (Handlungswissen), und solcher, die sich auf spezielle Einzeheiten oder Daten bezieht (Faktenwissen). Dies entspricht älteren Einteilungen gespeicherter Information in z.B. 'Wissen Wie' vs. 'Wissen Was' von RYLE.[4]
Die zuvor beschriebenen Tatsachen scheinen jetzt zu bestätigen, daß das Nervensystem dieselbe Unterscheidung trifft, d.h. daß diese beiden Bereiche der Information von grundsätzlich verschiedenen neuronalen Strukturen gespeichert werden.
COHEN[5] hat die Brauchbarkeit dieser Unterscheidung für die Erforschung der neuronalen Organisation des Gedächtnisses genauer untersucht. Er betrachtet Handlungswissen als 'implizites' Wissen, das nur durch Benutzung zugänglich ist. Viele Fertigkeiten (Musik, Sport, etc.) erfordern bei der Ausübung kein Erinnern an Orte und Zeiten bei denen sie verbessert oder erworben wurden. Solche, in der Vergangenheit liegenden, Handlungsereignisse ändern die Regeln nach denen der Organismus reagiert, hinterlassen demnach 'Spuren', sind aber dem direkten Zugriff nicht zugänglich. Das kritische Merkmal des Handlungswissens ist hierbei, daß:
"there can develop in memory a representation based on experience that changes the way the organism responds to the environment, without affording access to the specific instances that led to this change. Accordingly, procedural learning applies to more than just the acquisition of motor skills."[6]
Ganz sicher kein Zufall ist es darum, wenn sich Eric HALGREN und G.A. OJEMANN diencephalische Strukturen für ihre Stimulationsexperimente ausgesucht haben.[7] Eine Reihe von Hinweisen auf modalitätsspezische Speicherung (Frage (iv)) beispielsweise findet sich in HALGRENs Ergebnissen:
- Stimulation beliebiger Bereiche des Limbischen Systems erzeugt Gefühle, hauptsächlich Angst.
- werden der Hippocampus oder die Amygdalae stimuliert, berichten die Vpn von lebhaften Halluzinationen oder starken 'deja vu' Erlebnissen.
- Bewegungsabläufe können durch Stimulation des Gyrus Cinguli provoziert werden.
HALGREN berichtet auch ein Ergebnis, das COOPER & IMBERT[8] mittels ihres formalisierten visuellen Systems in ähnlicher Form gefunden hatten:
Der spezielle Erlebnisinhalt ist unabhängig von der genauen Position der Reizelektrode. Was erlebt wird scheint eher mit der allgemeinen Stimmung oder Haltung der Vpn zusammenzuhängen. Eine direkte Beziehung zwischen einzelnen Neuronen und mentalen Inhalten existiert nicht.
COOPER & IMBERT hatten in ihren Computersimulationen gefunden, daß die Spezialisierung von Units[9] unabhängig von der Modellstruktur ist: Nach Verlust der Spezialisierung infolge zeitweiliger Verringerung des Rauschabstands, konnte sich das Unit auf ein ganz anderes Muster spezialisieren. Es hing demnach von der Geschichte der visuellen Stimulationen ab, worauf die Neuronen letztendlich reagierten.
Hinweise darauf, wie die Organisation innerhalb des Diencephalons aussehen könnte, stammen wieder aus der Pathologie:
Elliott D. ROSS[10] hat verschiedene amnestische Syndrome aus der Literatur hinsichtlich ihrer anatomischen Befunde verglichen. Dabei zeigte sich, daß bestimmte Verletzungen zu scharf abgrenzbaren modalitätsspezifischen anterograden Amnesien führen. Dies kann prinzipiell zwei Ursachen haben:
- Die Verletzungen liegen in Bereichen, die für eine modalitätsspezifische Speicherung zuständig sind. Das wäre ein Hinweis auf eine Trennung der Sinne, analog zur Unterscheidung von Handlungswissen vs. Faktenwissen (s.o.) die u.a. von SQUIRE & COHEN getroffen wurde.
- Denkbar ist auch, daß der Informationszufluß bestimmter Modalitäten in eine, nur für Faktenwissen zuständige, Gedächtnisregion durch die Verletzungen unterbrochen wurde. Eine solche Instanz müßte Projektionen aus verschiedenen sensorischen Arealen, beispielsweise des Neocortex erhalten.
Eine eingehende Betrachtung der anatomischen Befunde weist die zweite Alternative als die warscheinlichere aus. ROSS beschreibt z.B. den Fall einer eng begrenzten Amnesie:
Nach einem Umzug in ein neues Drei-Zimmer-Appartment hatte dieser Patient große Schwierigkeiten sich darin zurechtzufinden. Jedesmal, wenn er in ein anderes Zimmer gehen wollte, mußte er seine Wohnung sprichwörtlich erforschen als ob er sich das erste Mal darin befände.
Besuchte dieser Patient seine Eltern, in deren Wohnung er aufgewachsen war, hatte er keine derartigen Probleme. Es handelte sich also um eine anterograde visuelle Amnesie.
E.G. JONES und T.P.S. POWELL[11] haben die Bahnen der verschiedenen sensorischen Cortices innerhalb einer Hemisphäre bei Affen kartiert, und dadurch gezeigt, daß diese alle konvergierend in die infero-medialen Temporallappen projizieren.
Der anatomische Befund des eben geschilderten Falls zeigt, daß hier die Projektionen aus dem primären visuellen Cortex verletzt sind.
Erkenntnisse dieser Art haben die 'Endstation' der konvergierenden Projektionen der primären sensorischen Cortices in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
Nicht zuletzt durch die totalen Amnesien, wie die von Fall H.M., ist der Hippocampus (HC) zum Gegenstand zahlreicher Theorien und experimenteller Arbeiten im Bereich der Gedächtnisforschung geworden.[12] Nach dem sich die Verwirrung über die tatsächliche(n) Funktion(en) dieser Struktur gelegt hatte, herrscht nun weitgehend Einigkeit darüber, daß der Hippocampus eine tragende Funktion bei bestimmten Gedächtnisprozessen innehat.[13]
Wie diese Prozesse organisiert sind, wie die Information repräsentiert ist und welche Ausfälle bei Läsionen am HC zu erwarten sind, ist noch Gegenstand von Forschung und engagierter Auseinandersetzung. Mindestens zwei grundsätzlich verschiedene Positionen lassen sich bislang unterscheiden:
D.S. OLTON J.T. BECKER und G.E. HANDELMANN[14] vertreten die Position, der HC sei ein Arbeitsgedächtnis und mit der Speicherung räumlicher Proportionen betraut. Diese Annahme basiert auf Experimenten mit Ratten in sternförmigen Achtarmlabyrinthen. Die Tiere müssen lernen aus jedem Arm eine Futterpille zu holen, ohne in einen bereits durchlaufenen Arm zu gehen. HC-Läsionen haben einen vernichtenden Effekt auf dieses Verhalten. Nach OLTONs Ansicht, gibt es außerhalb des HC ein weiteres Gedächtnissystem, das er als 'reference memory' bezeichnet. Dort sollen Verhaltensweisen gespeichert sein, die sofort und ohne Modifikation auf eine Situation anwendbar seien. Eine Verletzung des HC dürfte demnach keine Auswirkung auf solche Verhaltensweisen haben.
Die bisherigen Befunde scheinen diese Position zu tragen.
TOLMANs Konzept der 'cognitive map' haben sich J. O'KEEFE und L. NADEL zur Grundlage ihrer Position gemacht. Das stärkste Argument dafür stammt aus 'single-unit-recordings' von sich frei bewegenden Ratten: Einzelne Zellen sind nur aktiv, wenn sich das Tier an einem bestimmten Ort befindet. HC-Läsionen haben in Ergänzung zu dieser Beobachtung den Effekt, daß die Tiere sich keine Orte mehr, wohl aber Schlüsselreize merken können.
Diese Theorie will ich etwas ausführlicher referieren.
Das Konzept der 'Cognitive Map' (CM) ermöglicht die Integration von vier unabhängig voneinander beobachteten Phänomenen:
- Die Existenz sogenannter 'ortscodierter' Neuronen (s.o.) in freilaufenden Ratten und Kaninchen.
- Die Beziehung von Bewegung der Ratte und Theta-Rhytmus im HC derselben.
- Das Fehlen von Ortslernen und Erkundungsverhalten bei Tieren mit HC-Läsionen.
- Die tiefgreifenden Amnesien bei Menschen nach Verletzungen des HC.
Sehr viel Aufmerksamkeit verwenden O'KEEFE & NADEL auf die klare Definition ihrer Begriffe. Da es sich um ein Gedächtnissystem handeln soll, welches der räumlichen Abbildung der Umwelt dient, enthält ihr Ansatz eine Diskussion verschiedener Raum-Theorien und damit zusammenhängend, eine Gegenüberstellung von euklidischer und nicht-euklidischen Geometrien.
Auch die TOLMANsche Definition einer Cognitive Map ist ihnen nicht präzis genug. Um diesen Begriff scharf erfassen zu können, postulieren sie zwei Systeme die der räumlichen Orientierung dienen:
- 'taxon'-Systeme speichern durch den Aufbau eines Kategoriensystems auf der Basis von Abstraktion und Generalisierung. Zwei Begriffe liegen umso näher beieinander je mehr ihrer physikalischen Pendants sich gleichen. Die Güte der Speicherung hängt von der Anzahl der Wiederholungen des jeweiligen Reizes ab. Mithilfe eines solchen Systems kann ein Tier zwei Strategien zur räumlichen Orientierung, sogenannte Route-Strategien, entwickeln:
- Guidance-Hypothesen identifizieren Objekte oder 'cues', denen sich das Tier nähern kann bzw. die es vermeiden sollte.
- Orientierungs-Hypothesen sind die Information darüber, wie sich das Tier zu orientieren hat, also eine Präzisierung der Guidance-Hypothesen. Genau handelt es sich bei diesen Informationen um Bewegungsvorschriften in einem egozentrischen räumlichen Koordinatensystem, dessen Ursprung und Achsen mit den Augen, dem Kopf oder mit dem Körper zusammenfallen können.
- 'locale'-Systeme - In einem Locale-System werden Informationen nicht nach Ähnlichkeit wie in einem Taxon-System, sondern entsprechend ihrer räumlich vorfindbaren Relationen zueinander gespeichert; das Lokale-System konstruiert eine Kopie der Umwelt. Dies ist der Begriff einer Cognitive Map von O'KEEFE & NADEL. Ein Lokale-System besitzt die folgenden kritischen Attribute:
- Die Abbildung erfolgt durch schrittweises Hinzufügen von Elementen aus der Umgebung nach einem Alles-oder-Nichts-Prinzip;
- es gibt nur schwache Interferenzen zwischen ähnlichen Objekten, da sie an verschiedenen Orten abgebildet werden;
- die Güte der Speicherung wird durch mehrmaliges Aufsuchen eines Ortes kaum verändert, da es ja viele verschiedene Wege zu ihm gibt;
- das Abbildungssystem ermöglich ein Agieren auf Entfernung, falls Start und Ziel auf derselben Abbildung repräsentiert sind.
Da sich das Hauptaugenmerk der beiden Autoren auf die Konstruktion einer räumlichen Abbildung der Umwelt richtet, will ich an dieser Stelle etwas auf den hypothetischen Mechanismus und seine Grundlagen zu sprechen kommen:
- Anatomie des HC
Intern kann der HC in drei Bereiche untergliedert werden: Die Fascia Dentata, CA3 und CA1. Jedes dieser Systeme besteht aus einer Anordnung ähnlicher Projektionszellen sowie einer Anzahl Interneurone.
Der Haupstrom der Information entspricht dieser Reihenfolge, wobei die Projektionen außerordentlich genau sind.
- Afferenzen des HC
Der HC bezieht seine Information aus zwei Quellen: Vom entorhinalen Cortex (eC) einerseits und vom medialen Septum und dem Hirnstamm andererseits.
Der eC erhält viel Information von den sensorischen Arealen des Neocortex. Es ist daher anzunehmen, daß der HC auf diesem Weg bereits gut integrierte Information über die Umgebung erhält. Anatomische und physiologische Untersuchungen haben gezeigt, daß die Projektionen aus dem eC in den HC genauso exakt geführt sind, wie die innerhalb des HC.
Die aus dem Hirnstamm eintreffende Information verteilt sich dagegen sehr viel diffuser. Es besteht Grund zu der Annahme, daß diese unspezifisch verteilte Information mit dem Auftreten des Theta-Rhytmus im HC zusammenhängt. Da der Hirnstamm durch Bewegungen des Tieres aktiviert wird, könnte der HC auf diese Weise zu Informationen über den Bewegungszustand kommen.
- Theta-Rhytmus
Die Funktion der Theta-Wellen läßt sich am besten als Ordnungsfunktion bezeichnen. Angenommen, die Erregbarkeit der Granulocytendendriten schwankt in eben diesem Theta-Rhytmus, dann kommt ihm die Funktion eines Kreuzkorrelators oder eines Synchronisators zu.
- Theta und Verhalten
Theta-Wellen treten vorwiegend im Laufe willkürlicher Bewegungen auf; bei unwillkürlichen Bewegungen dagegen, zeigt das HC-EEG starke und unregelmäßige Spitzen. Nimmt man an, daß die spezielle Frequenz der Theta-Wellen mit der Fortbewegungsgeschwindigkeit des Tieres kovariiert, dann würden die räumlichen Gegebenheiten entsprechend ihrer Distanz sortiert.
- zwei Sorten HC-Zellen
Single-Unit-Recordings aus dem HC deuten auf zwei Sorten von Zellen hin: 'Theta-Zellen' und 'ortscodierende Zellen'.
Die ortscodierenden Zellen sind jene, die nur in einer ganz bestimmten Umgebung aktiv sind. Innerhalb dieser Gruppe lassen sich wiederum sogenannte 'place' und 'misplace' Zellen unterscheiden. Das sind Detektoren, die entweder das Fehlen oder das Vorhandensein bestimmter Reize anzeigen.
Die Aktivität der Theta-Zellen ist kongruent mit dem HC-Theta-Rhytmus und besitzt auch dieselben Verhaltenskorrelate.
Soweit das Modell der Cognitive Map von O'KEEFE & NADEL in der Theorie.
Zur Beurteilung der Brauchbarkeit haben O & N eine Reihe unterschiedlichster Lernparadigmen an Ratten ohne HC ausprobiert. In kurzen Stichworten sehen die Ergebnisse folgendermaßen aus:
- Explorationsverhalten: Keine systematische Erforschung Erforschung der Umgebung mehr -> keine Abbildung möglich.
- Diskriminationslernen: Keine Benutzung lokaler Hypothesen.
- diskriminatives Umkehrtraining: Nicht eindeutig - Ratten und Katzen haben Probleme, während bei Affen kein Effekt zu sehen ist.
- komplexe Labyrinthe: Schlechtere Ergebnisse als normale Ratten.
- Vermeidungslernen
- one-way: gibt man einen CS als Cue, dann findet sich kein Unterschied.
- two-way: Ohne HC besser -> kein Lernen des 'sicheren' Orts.
- passiv: Keine Vermeidung des Orts aber sobald Guidance-Hypothesen (Cues) möglich sind Vermeidung.
- Konditionierung
- klassisch: Keine Effekte.
- operant: normalerweise keine Effekte - aber: wenn lange Pausen zwischen dem Drücken eines Futterhebels verlangt werden, wissen Tiere ohne HC nicht wohin und drücken zu früh -> Futter weg. Mit einem Cue gibts keine Unterschiede mehr.
- spatial delayed response und spatial alternation: Beides braucht räumliche Information -> Ohne HC geht nichts.
- Extinktion: Ohne HC ist die Dauer stark erhöht. Kovariiert mit der Anzahl erfolgloser Versuche -> nur Taxon-System.
- Frustration: keine Unterschiede - auch nicht bezüglich Aggression.
- Sonstnochwas: Eine Anzahl indirekter Effekte auf Territorial- und Aufzuchverhalten - schwankt stark mit der experimentellen Technik.
- Modellevaluation[15]
| Phänomen | Transformationen[16] | hypothetischer Mechanismus | Quellen |
|---|---|---|---|
| permanentes (Langzeit-)Gedächtnis >>Engramme<< | Bewegung und Informationsaufnahme ====> ortscodierte Neuronen | Taktfrequenz steuert Verteilung der Information auf Zellen | Digitaltechnologie |
Das oben analysierte Modell von O'KEEFE & NADEL ist nur eine Möglichkeit aus mehreren, die zahlreichen Befunde zum Sitz des Gedächtnisses in einem funktionellen Gedächtnismodell zu integrieren. Wegen seines stark spekulativen Charakters ist dieses Modell Ziel von Kritik gewesen, die sich vor allem gegen das dünne empirische Fundament richtete.
Das ist genau der Grund weshalb ich es hier ausgesucht habe. Folgt man nämlich der Logik HARREs, so reicht bereits eine fixe Idee, um einen imposanten Paramorphismus zu konstruieren.
Wie schon in den zuvor beschriebenen Modellen ist es auch hier praktisch unmöglich, alle Quellen zu rekonstruieren. Wenn mein Eindruck von der Digitaltechnologie als einer Quelle richtig ist, dann handelt es sich hier um einen Paramorphismus der völlig legitim zur Formulierung existentieller Hypothesen herangezogen werden kann.
Der hypothetische Mechanismus ist auch in diesem Modell nicht vollständig geklärt. Der Grund mag darin liegen, daß O & N ihr Modell als Homomorphismus begreifen oder begriffen haben wollen. Dies zwingt sie, eventuell ungerechtfertigte Annahmen über die funktionale Organisation des HC erst gar nicht zu formulieren, was sich darüberhinaus noch als mangelnde Konsequenz und logische Inkonsistenz interpretieren läßt.
Was bleibt, ist die Überprüfung der einzig möglichen existentiellen Hypothese: Gibt es eine Cognitive Map (Lokale-System)?
Das umfangreiche empirische Datenmaterial scheint mir für eine Unterstützung dieser Hypothese gut geeignet zu sein.
Was zu tun bleibt, ist, einen exakten Paramorphismus zu konstruieren, dessen hypothetischer Mechanismus unter Umständen noch eine Reihe weiterer Quellen erforderlich machen wird.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ Newcombe,F. (1980): Memory: a neuropsychological approach. S.179f
- ↑ Talland,G. (1969) nach Newcombe,F. (1980) S.180
- ↑ Cohen,N.J. & Squire,L.R. (1980) nach Squire,L.R. (1982) S.259
- ↑ Ryle,G. (1949) nach Squire,L.R. (1982) S.260
- ↑ vgl. Cohen,N.J. (1981) nach Squire,L.R. (1982) S.260
- ↑ Squire,L.R. (1982) S.260
- ↑ Halgren,E.: Mental Phenomena Induced by Stimulation in the Limbic System. Ojemann,G.A.: Models of the Brain Organization for Higher Integrative Functions Derived with Electrical Stimulation Techniques.
- ↑ vgl. Cooper,L.N. & Imbert,M. (1981)
- ↑ der Term 'Unit' bezieht sich auf die symbolischen Neuronen in den Simulationen von C & I , vgl. 'Wie? - Synapsen!' in diesem Kapitel
- ↑ Ross,E.D. (1982): Disorders of recent memory in humans.
- ↑ vgl. Jones,E.G. & Powell,T.P.S. (1970) nach Ross,E.D. (1982) S.171
- ↑ Drachman,D.A. & Hughes,J.R. (1971): Memory and the Hippocampal Complexes. Cotman,C.W. & Nadler,J.V. (1978): Reactive Synaptogenesis in the Hippocampus. Halgren,E. Babb,T.L. Crandall,P.H. (1978): Activity of Human Hippocampal Formation and Amygdala Neurons During Memory Testing. Olton,D.S., Becker,J.T., Handelmann,G.E. (1979): Hippocampus, Space and Memory. O'Keefe,J. & Nadel,L. (1979): The Hippocampus as a Cognitive Map (Multiple Book Review). Sahgal,A. (1980): Functions of the Hippocampal System.
- ↑ vgl. Morris,R. (1982): New approaches to learning and memory. Sahgal,A. (1980): Functions of the hippocampal system.
- ↑ Olton,D.S., Becker,J.T., Handelmann,G.E. (1979): Hippocampus, Space and Memory.
- ↑ vgl. Kap.1: 'Modell & Theorie'
- ↑ um eine Unterscheidung von modalen und kausalen Transformationen zu gestatten, benutze ich die Symbole '===>' für kausale, und '<===>' für modale Transformationen.