Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Modell und Theorie
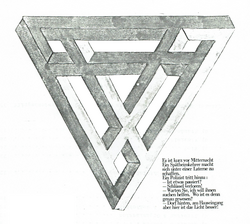
|
Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |
- Modell & Theorie
Dieser Abschnitt hat zum Ziel, einen Modellbegriff zu finden der (1) selbst formal präzis definiert ist, und (2) dessen Position innerhalb einer Theorie genau definiert ist.
Nach STACHOWIAK[1] lassen sich drei Hauptmerkmale von Modellen identifizieren:
- Abbildungsmerkmal: Modelle sind immer Abbildungen von etwas, das selbst wiederum auch ein Modell sein kann. Jede Entität wird zum Modell, wenn sie durch eine geeignete Abbildungsvorschrift einer anderen Entität zugeordnet wird.
- Verkürzungsmerkmal: Es werden nur die Originalattribute entsprechenden Modellattributen zugeordnet, die als signifikant angesehen werden. Es gibt also prinzipiell unendlich viele mögliche (= denkbare) Modelle desselben Originals.
- Pragmatisches Merkmal: Welches der denkbaren Modelle letzendlich benutzt wird, hängt (1) vom jeweiligen Forscher, (2) vom speziellen Zeitraum und (3) von den jeweils interessierenden konkreten oder abstrakten Operationen ab.
Diese Charakterisierung ist unmittelbar plausibel, trägt aber eher deskriptive als analytische Züge und erscheint mir darum als Basis einer Begriffsklärung zu schwach.
Die 'mathematische Modelltheorie'[2] liefert einen sehr exakten und analytisch brauchbaren Modellbegriff, der über die Termini 'abstrakte relationale Struktur' (A.R.S.) und 'Theorie' definiert ist.[3] Dies soll im Folgenden genauer beschrieben werden:
Eine axiomatisierte Theorie erhält man durch Beschreibung einer 'Struktur'[4] zusammenhängender kanonischer Konzepte, der sogenannten 'abstrakten relationalen Struktur' (A.R.S.) die sich auch in der Form
A = {a1,a2,...,an}
darstellen läßt. Die Theorie heißt dann entsprechend 'Theorie von A' oder T(A). Ein Modell schließlich erhält man durch eine Interpretation 'm' der Elemente von A,
M = {m(a1),m(a2),...,m(an)}
d.h. 'Modell' bezeichnet zunächst eine Menge konkreter Einheiten, deren Relationen den Axiomen und Sätzen der 'Theorie von A' genügen müssen. Die 'Theorie von A' ist dann auch eine 'Theorie des Modells';
T(A) = T(M).
Im Folgenden gebe ich die Definitionen für drei recht nützliche Eigenschaften dieses Modellbegriffs wieder:
Def.:
Sei T(A) eine abstrakte Theorie mit der kanonischen Basis A={a1,a2,...,an} bestehend aus n nichtlogischen Konstanten; weiter sei M={m(a1),m(a2),...,m(an)} der Wert einer Interpretation 'm' auf A, die keine bloße Permutation der Elemente von A bewirkt.
Dann hat M den 'syntaktischen Rang' n, den 'semantischen Rang' m_n und den 'Abstraktionsgrad' alpha=1-m/n.
Def.:
M={m(a1),m(a2),...,m(an)} ist ein 'volles Modell' von A={a1,a2,...,an} <=> alpha=0; und M ist ein 'partielles Modell' von A <=> 0 < alpha < 1.
Die für die folgenden Ausführungen relevanten Punkte fasse ich nochmals zusammen:
- Die Gemeinsamkeiten von Elementen des Modells und Elementen der abstrakten relationalen Struktur beschränken sich auf den gemeinsamen Index, d.h. a1 entspricht m(a1) usf.
- Die Beziehungen zwischen den Elementen einer Struktur bzw. eines Modells werden durch eine Theorie definiert (%T(A) bzw. T(M)%); sie existieren nicht per se.
- Daraus folgt, daß eine Theorie konkreter Phänomene, also mit alpha%<%1, mindestens ein partielles Modell erfordert; keine Theorie ohne Modell also!
Ein so definierter Modellbegriff scheint für die Forschungspraxis (noch) nicht sehr brauchbar zu sein; es bedarf dazu einer kleinen Operation, denn:
Der Wissenschaftler sucht keine Modelle für irgendeine A.R.S., sondern für konkret (empirisch!) vorgefundene Phänomene.
Das aber hieße, daß Wissenschaft darin besteht, Realität (das Phänomen) mit Realität (das Modell) zu vergleichen, was einer schlichten Phänomen-Kategorisierung gleichkäme. Dem ist aber nicht so: Der Forscher konstruiert (wenigstens implizit) aus seinem Betrachtungsfeld heraus eine A.R.S. indem er relevante Einheiten definiert. Dann erst kann er ein Modell konstruieren, indem er diese A.R.S. in einem anderen Realitätsbereich reinterpretiert.
Der obige Einwand kann also zurückgewiesen werden.
Rom HARRE1 hat seinen Modellbegriff ebenfalls in engem Zusammenhang mit dem der Theorie definiert. Obwohl er nicht axiomatisch-formal vorgeht, sondern Modelle im Rahmen einer neuen Strategie der Theorie-Konstruktion abhandelt, eröffnet sein Modellbegriff, vereinigt mit dem der Mathematiker, eine fundierte und praktikable Strategie kreativer wissenschaftlicher Arbeit.
Sein Konzept von Theorien ist etwas breiter als das der Mathematiker:
Theorien werden als Lösung einer speziellen Art von Problemstellung betrachtet, nämlich 'Wie kommt es, daß uns Phänomene auf genau die Art und Weise erscheinen, wie dies eben der Fall ist?'
Eine Theorie hat demnach die Aufgabe einer Rekonstruktion uns verborgener Mechanismen. Dies erfordert u.U. (meist!) ein 'Auffüllen' von bestehenden Wissenslücken. So gelangt man über die Forderung einer Rekonstruktion zur Konstruktion eines Modells, welches auf Prozessen und Materalien basiert die uns bekannt sind und die wir verstehen. Solche Theorien bestehen billigerweise aus mindestens drei Mengen von Sätzen: Eine zur Beschreibung des Phänomens (1), eine weitere zur Beschreibung des Modells (2), und schließlich mindestens eine zur Beschreibung des Materials aus dem das Modell besteht (3-N).
Um eine zu breite, und damit nichtssagende Verwendung des Wortes 'Modell' auszuschließen, führt Harre eine 'Taxonomie von Modellen' ein, die im Wesentlichen zwischen 'ikonischen' und 'sententiellen' Modellen sowie zwischen 'Modellen für' und 'Modellen von' differenziert:
Seien T und T' Mengen von Sätzen mit Elementen p bzw. q.
Def.:
Dann ist T' ein 'sententielles Modell' von T, wenn es für jedes p in T ein q in T' gibt, so daß gilt: 1. q -> p (wenn q zulässig ist, dann ist p wahr), und 2. ^p -> ^q (wenn p falsch ist, dann ist q unzulässig).
Def.:
M ist ein 'ikonisches Modell' von N, wenn M von T' bzw. N von T beschrieben wird, und T' ein sententielles Modell von T ist.
Für die zweite Trennung wird es notwendig, zwischen der 'Quelle' und dem 'Subjekt' eines Modells zu unterscheiden:
- Quelle ('source') steht für den inhaltlichen Bereich der dem Modell zugrundeliegt;
- Subjekt hingegen bezeichnet den inhaltlichen Bereich, der modelliert werden soll.
Ein 'Modell von' ist dann durch die Eigenschaft >Quelle = Subjekt< hinreichend beschrieben und heißt bei Harre 'Homomorphismus';
beim 'Modell für' gilt: >Quelle ^= Subjekt<, das Etikett heißt 'Paramorphismus'.
Das Interesse Harres gilt vor allem den Paramorphismen. Da diese Modelle einem anderen inhaltlichen Kontext entstammen als das zu modellierende Subjekt, ermöglichen sie die Formulierung sogenannter 'Existenzhypothesen'. Diese sind Hypothesen, die auf die Existenz von Einheiten abzielen, welche denen des Modells analog sind, und noch nicht als Bestandteil des Subjekts erkannt worden sind. Auf diese Weise wird die Konstruktion eines Modells zum kreativen Akt bei der Entwicklung von Theorien.
Innerhalb der Menge von Sätzen, die das Modell beschreiben (s.o.(2)), verdienen diejenigen, welche die Phänomene mit dem hypothetischen Mechanismus verbinden besondere Aufmerksamkeit. Diese Verbindungen von Mechanismen und Oberflächenphänomenen können nach Harre zwei verschiedene Formen annehmen:
- kausale Transformationen: Bestimmte Zustände des Mechanismus' bewirken andere Zustände, die der Beobachtung als 'Phänomen' zugänglich sind. Ein prominentes Beispiel ist die Erklärung der kinetischen Gastheorie für das Zustandekommen des Gasdrucks.
- modale Transformationen: Diese Verbindungen beschreiben lediglich Veränderungen der verwendeten Termini beim Wechsel des Betrachtungsniveaus. Auch dafür liefert die kinetische Gastheorie ein Beispiel. Die Wärme eines Gases läßt sich ebenso als die 'mittlere kinetische Energie' aller seiner Moleküle beschreiben, je nachdem welches Analyse- oder Betrachtungsniveau gewählt wird.
Diese Unterscheidung ist sinnvoll, da sie eine Trennung von Theorien in Phänomen-Erklärungen und Phänomen-Beschreibungen erlaubt. Letztere enthalten keinerlei 'kausale Transformationen', weshalb Harre sie als 'Metaphern' bezeichnet.
Auf der Grundlage dieser Terminologie schlägt Harre eine Methode zur Analyse von Theorien und den darin enthaltenen Modellen vor. Vier Komponenten der Theorie bilden die Grundlage der Analyse: Das Phänomen, die Transformationen, der hypothetische Mechanismus und dessen Quellen.
Anhand DARWINs Theorie von der Entstehung der Arten läßt sich das in prägnanter Weise demonstrieren:
| Phänomen | Transformationen | Hypothetischer Mechanismus | Quellen |
|---|---|---|---|
| Vielfalt der Arten | Ursache der Artenvielfalt ist die natürliche Selektion | Natürliche Selektion im 'Kampf ums Dasein' |
|
Ein Paramorphismus, das eigentliche Kernstück jeder Theorie, ist der unter Bezugnahme auf die Quelle(n) formulierte hypothetische Mechanismus. Kausale und modale Transformationen verbinden diesen Mechanismus mit beobachtbaren Phänomenen, der Empirie also.
Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann
- ↑ Stachowiak,H.: Allgemeine Modelltheorie, xxxx, S.131
- ↑ Potthoff,K.: Einführungen in die Modelltheorie und ihre Anwendungen, 1981
- ↑ BUNGE,M.: Treatise on Basic Philosophy (Semantics II: Interpretation and Truth), 1974, S.3ff
- ↑ Der Strukturbegriff der Mathematiker ist ein völlig anderer als der alltagssprachliche. 'Struktur' bezeichnet hier lediglich eine geordnete Menge (ein 'n-Tupel') gewisser Elemente, deren Relationen (noch) nicht festgelegt sind. Auch steht er in Widerspruch zu dem von MATURANA (vgl. Abschnitt 'Struktur & Organisation') verwendeten Strukturbegriff, der Elemente %u%n%d% Relationen erfaßt.